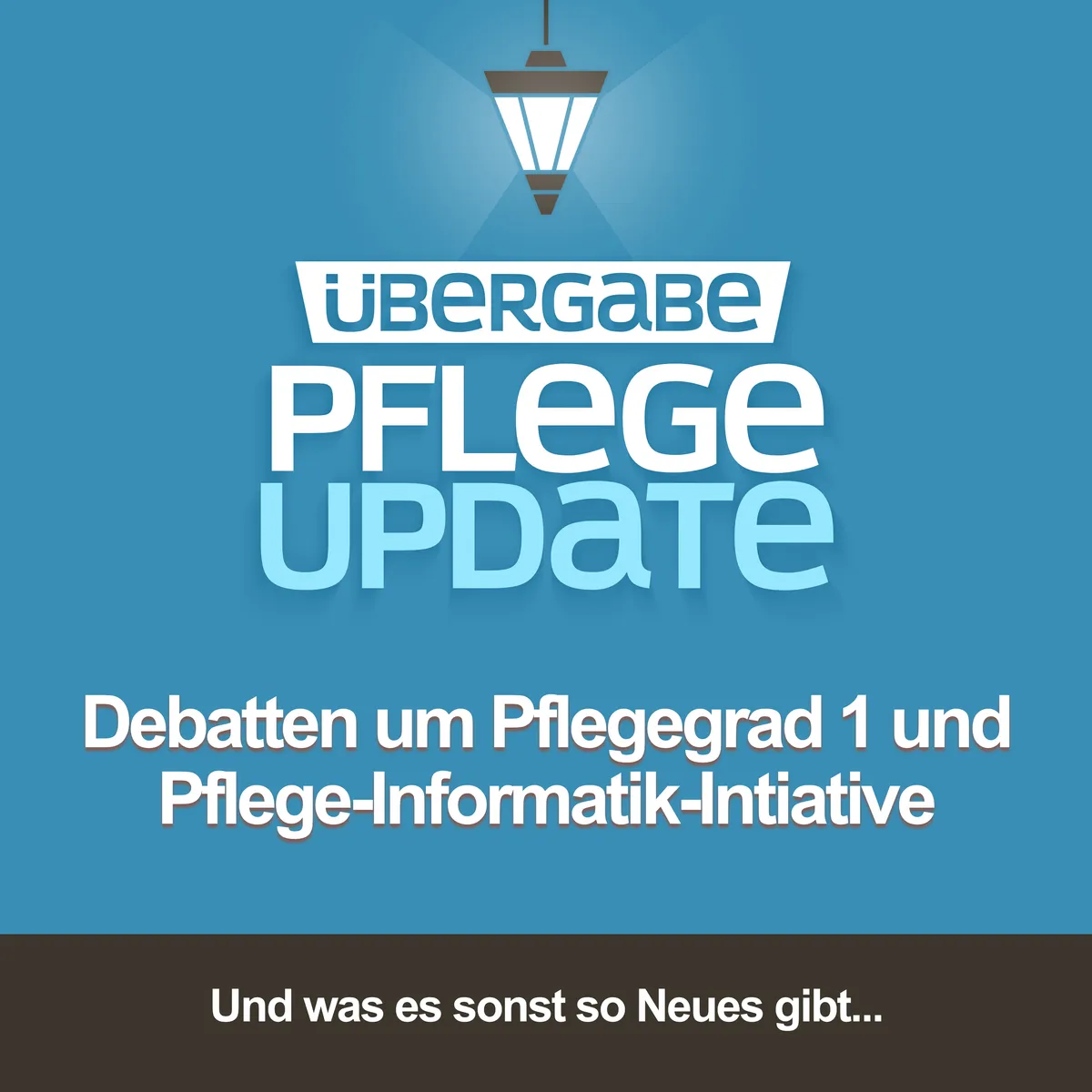Bedeutung von Pflegegrad 1 für die Versorgung
Pflegegrad 1 umfasst in Deutschland rund 860.000 Menschen mit leichten Einschränkungen in ihrer Selbstständigkeit. Dazu gehören vor allem Personen mit beginnender Demenz, Einschränkungen der Mobilität oder kognitiven Problemen. Die Leistungen sind auf den ersten Blick begrenzt: 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich, Zuschüsse für Hilfsmittel, ein Hausnotruf oder Mittel für barrierefreie Umbauten.
Trotz der geringen Summen haben diese Leistungen erhebliche Wirkung. Sie ermöglichen Selbstständigkeit, reduzieren das Risiko von Krankenhausaufenthalten und entlasten pflegende Angehörige. Damit erfüllen sie eine präventive Funktion, die im Gesamtsystem Kosten vermeidet.

Politische Hintergründe der Debatte
Ab dem Jahr 2026 wird in der Pflegeversicherung eine Finanzierungslücke von rund zwei Milliarden Euro erwartet. Ein Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sieht vor, Pflegegrad 1 zu streichen. Mit dieser Maßnahme könnten etwa 1,8 Milliarden Euro eingespart werden.
Die politische Diskussion zeigt ein geteiltes Bild: Während Teile der Bundesregierung die Streichung als Beitrag zur Stabilisierung der Pflegeversicherung sehen, warnen Fachverbände wie die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und die Deutsche Alzheimergesellschaft vor gravierenden Folgen für Betroffene und Angehörige.
Auswirkungen auf Patient:innen und Angehörige
Die Abschaffung von Pflegegrad 1 hätte direkte Konsequenzen für Betroffene. Unterstützungsleistungen wie Haushaltshilfen, Betreuungsgruppen oder Zuschüsse zu Hilfsmitteln würden entfallen. Dies erhöht das Risiko einer Verschlechterung des Gesundheitszustands, beschleunigt den Übergang in stationäre Pflege und steigert die Belastung pflegender Angehöriger.
Auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive sind die Folgen relevant: Kurzfristige Einsparungen würden langfristig höhere Kosten verursachen, da präventive Leistungen entfallen und akute Versorgungslücken entstehen.

Pflegeinformatik als strukturelle Grundlage
Parallel zu dieser Debatte liegt mit der Pflegeinformatik-Initiative des Deutschen Pflegerats ein Vorschlag vor, der die digitale Infrastruktur in der Pflege verbessern soll. Ziel ist die Einführung eines bundesweit einheitlichen Kerndatensatzes Pflege, um pflegerische Leistungen vergleichbar und auswertbar zu machen.
Die derzeitige Situation ist durch uneinheitliche Dokumentationssysteme geprägt. Unterschiedliche Softwarelösungen sind häufig nicht kompatibel, wodurch pflegerische Arbeit in Forschung und Politik weitgehend unsichtbar bleibt.

Zentrale Forderungen der Pflegeinformatik-Initiative
Die Initiative umfasst mehrere zentrale Maßnahmen:
- Aufbau eines Kerndatensatzes Pflege zur standardisierten Datenerfassung
- Einrichtung von Pflegedatenzentren zur Analyse und Nutzung der Informationen
- Investitionen in digitale Infrastrukturen in Einrichtungen
- Stärkung von Forschung und Lehre durch Professuren und Studiengänge im Bereich Pflegeinformatik
Diese Schritte sollen sicherstellen, dass pflegerische Leistungen sichtbar, messbar und evidenzbasiert bewertet werden können.
Internationale Entwicklungen
Andere Länder zeigen, wie Pflegedaten erfolgreich genutzt werden können. In Kanada dienen standardisierte Pflegedaten als Grundlage für Versorgungssteuerung und politische Entscheidungen. Auch in Skandinavien und den Niederlanden sind entsprechende Systeme etabliert und werden in den europäischen Gesundheitsdatenraum integriert.
Deutschland läuft Gefahr, in diesem Bereich den Anschluss zu verlieren. Ohne valide Daten bleibt die Pflege im politischen Diskurs benachteiligt und kann ihre Wirksamkeit nicht belegen.
Evidenzbasierte Steuerung von Pflegepolitik
Die systematische Erfassung von Pflegedaten ermöglicht eine präzisere Steuerung von Versorgung und Politik. Dazu gehören:
- die Bewertung pflegerischer Interventionen
- die Analyse regionaler Unterschiede in der Versorgung
- die Identifikation von Bedarfen für Forschung und Praxis
Für die Profession bedeutet dies, dass Pflegefachpersonen durch Daten gestärkt werden können, da ihre Arbeit messbar und belegbar wird.
Dieser Beitrag ist kostenlos und wird ermöglicht durch zahlende Mitglieder der Übergabe. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, dann unterstütze uns gern. Dafür bekommst du neben den regulären Newslettern auch Zugang zu exklusivem Content, wie unseren Briefings.
Organspende und die Widerspruchslösung
Ein zentraler Punkt der aktuellen gesundheitspolitischen Debatte betrifft die Organspende. Acht Bundesländer haben im Bundesrat eine Initiative für die Einführung der Widerspruchslösung eingebracht. Damit würde künftig jede volljährige Person automatisch als Organspender:in gelten, solange kein aktiver Widerspruch vorliegt. Ziel dieser Reform ist es, die Diskrepanz zwischen der hohen Zustimmung in der Bevölkerung und der geringen Zahl tatsächlich durchgeführter Organspenden zu verringern. In Deutschland warten derzeit rund 8300 Patient:innen auf ein Spenderorgan, während im Jahr 2024 nur etwa 2850 Organspenden registriert wurden. Die Einführung der Widerspruchslösung könnte Wartezeiten verkürzen und die Chancen auf eine erfolgreiche Transplantation erhöhen.
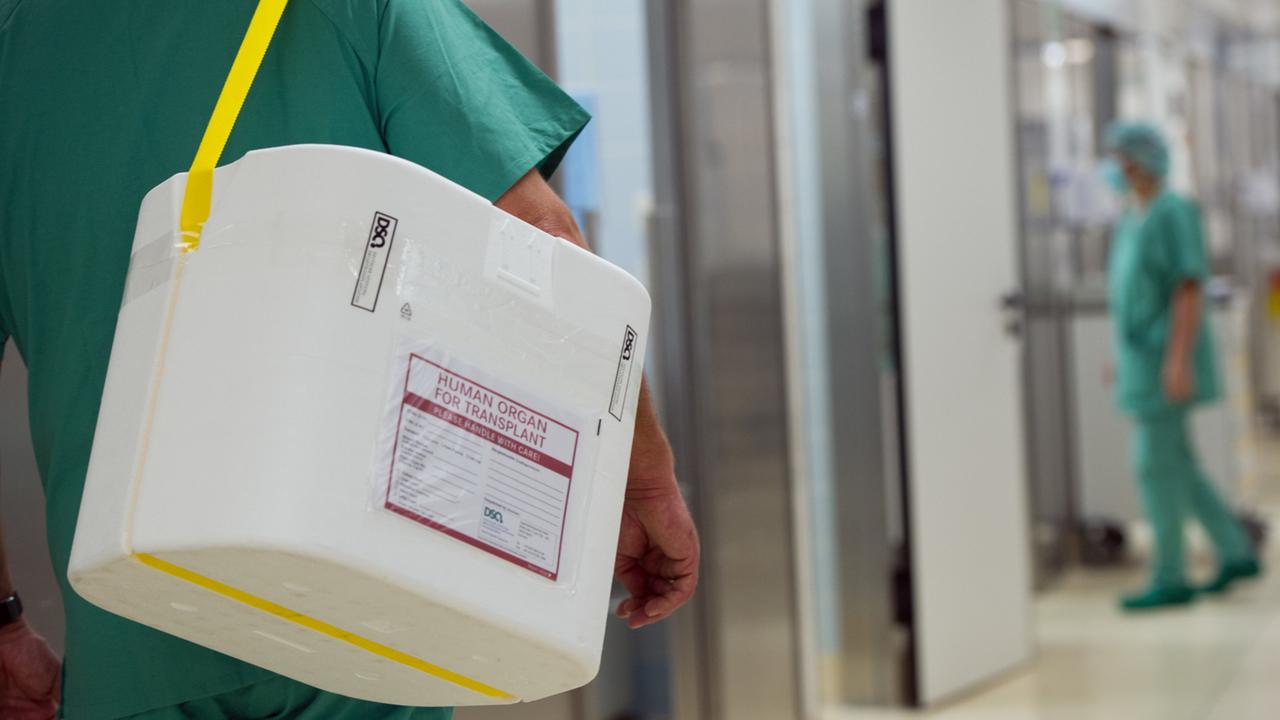
Bürokratieabbau im Gesundheitswesen
Ein weiteres Thema ist der Umgang mit bürokratischen Belastungen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft weist seit Langem darauf hin, dass die Vielzahl an Regulierungen und administrativen Vorgaben die Arbeit in den Einrichtungen erheblich erschwert. Pflegefachpersonen und Ärzt:innen verbringen viel Zeit mit Dokumentation und Verwaltung, die nur bedingt zur Verbesserung der Versorgungsqualität beiträgt. Reformen in den vergangenen Jahren hätten bislang kaum zu spürbaren Veränderungen geführt. Aus Sicht der Krankenhausgesellschaft ist es dringend erforderlich, administrative Strukturen zu verschlanken, damit mehr Zeit für die direkte Versorgung von Patient:innen bleibt und die Arbeitszufriedenheit des Fachpersonals steigt.

Ausblick
Die Debatte um Pflegegrad 1 zeigt, wie stark die Pflegepolitik von finanziellen Rahmenbedingungen geprägt ist und welche Auswirkungen Entscheidungen direkt auf Betroffene und Angehörige haben können. Gleichzeitig verdeutlicht die Pflegeinformatik-Initiative, dass die Profession durch eine bessere Datenbasis und digitale Strukturen an Sichtbarkeit und Gestaltungskraft gewinnen kann. Ergänzende Themen wie Organspende und Bürokratieabbau machen klar, dass strukturelle Veränderungen notwendig sind, um die Versorgung langfristig stabil und verlässlich zu gestalten. In den kommenden Monaten wird entscheidend sein, ob es gelingt, kurzfristige Lösungen mit einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Pflegesystems zu verbinden.
Veranstaltungen
Am 10. Oktober 2025 findet das 22. Osnabrücker Gesundheitsforum statt
„Nachhaltigkeit in der Pflege – Zwischen Umweltbewusstsein und Versorgungssicherheit“.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Pflegeeinrichtungen und Kliniken den Herausforderungen des Klimawandels begegnen können. Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis präsentieren aktuelle Forschungsergebnisse und diskutieren innovative Lösungen für eine klimaresiliente, zukunftsfähige Pflege.
👉 Eine spannende Gelegenheit, sich über nachhaltige Strategien im Gesundheitswesen auszutauschen und neue Impulse für die eigene Praxis mitzunehmen.