DPT - Tag 1
Der erste Tag des Deutschen Pflegetags zeigte, was Pflege in Deutschland aktuell bewegt: neue rechtliche Befugnisse, erweiterte Rollenprofile und der Mut, Verantwortung zu übernehmen – für Patient:innen, Communities und Gesellschaft. Direkt zu Beginn des Tages wurde Cagla Kurtçu mit dem Deutschen Pflegepreis für ihre Leistungen als Community Health Nurse und ihr unerschütterliches Engagement ausgezeichnet: Wir gratulieren von Herzen!
Pflege braucht Strukturen, Mut und Selbstverwaltung
Im Gespräch mit Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats (DPR), wurde deutlich: Pflege steht weiterhin zwischen Fortschritt und Stillstand. In ihrer Eröffnungsrede blickte sie auf die im vergangenen Jahr formulierten Ziele zurück – und auf das, was bisher erreicht wurde.
2024 hatte Vogler vier Kernpunkte benannt: Berufsautonomie, Selbstverwaltung, einheitliche Bildungsstrukturen und Handlungskompetenz. Zwar habe die Pflege in den politischen Diskursen an Sichtbarkeit gewonnen, etwa durch die Personalbemessung oder das Tariftreuegesetz, doch entscheidende Reformen blieben aus. Bundesweite Bildungsstandards, echte Handlungskompetenz und eine verbindliche Selbstverwaltung existieren bis heute nicht. Worte seien da, Taten würden noch fehlen, resümiert Vogler sinngemäß.
Für 2025 formulierte sie daher vier neue Schwerpunkte, die unmittelbar an die bisherigen Forderungen anknüpfen:
- Primärversorgungssysteme, in denen Pflegefachpersonen den ersten Zugang zum Gesundheitssystem steuern.
- Handlungskompetenz und Befugniserweiterung, also die rechtliche und praktische Umsetzung eigenständiger Entscheidungen.
- Eine einheitliche Bildungsarchitektur, die Pflegeausbildung, Studium und Weiterbildung verbindlich zusammenführt.
- Die Selbstverwaltung der Pflege, um politische und fachliche Entscheidungen mitgestalten zu können.
Vogler betonte in Anlehnung an das Kongressmotto #pflegebleibt, dass Pflege die erste verlässliche Adresse im Gesundheitswesen sei – kompetent, nah an den Menschen und oft diejenige Profession, die den ersten Kontakt herstellt. In zukünftigen Primärversorgungszentren müsse diese Rolle konsequent abgebildet werden.
Kritisch äußerte sie sich zur aktuellen Umsetzung des Befugniserweiterungsgesetzes. Zwar begrüßt sie das Prinzip, Pflege mehr Handlungsspielräume zu eröffnen, doch warnt sie davor, die Definition pflegerischer Kompetenzen an den GKV-Spitzenverband zu delegieren. Dieser habe eine völlig andere institutionelle Logik – ökonomisch, nicht professionsbezogen. Pflege, so Vogler, brauche die Möglichkeit, ihren Scope of Practice selbst zu definieren und Verantwortung aus eigenem Fachwissen heraus zu übernehmen. Die Angst, Pflege würde Kostenexplosionen verursachen, wenn sie verschreiben dürfte, hält sie für unbegründet: Pflegefachpersonen verordnen heute schon indirekt, indem sie Bedarfe erkennen und ärztliche Maßnahmen initiieren.
Ein zentrales Thema ihres Engagements bleibt die Selbstverwaltung. Vogler bezeichnet das Fehlen einer bundeseinheitlichen Vertretungsstruktur als sträfliche Vernachlässigung staatlicher Verantwortung. Weder existieren valide Daten über die Zahl, das Alter oder die Qualifikation von Pflegefachpersonen, noch kann die Profession eigene berufsrechtliche Standards setzen.
In Krisenzeiten – ob Pandemie, Demografie oder Bevölkerungsschutz – sei das ein strukturelles Risiko. Pflege könne derzeit keine Fortbildungspflichten festlegen, keine Qualitätsindikatoren steuern und keine eigenständige Berufsstrategie entwickeln, weil sie institutionell nicht verankert ist.
Vogler illustriert das Missverhältnis deutlich: Während in anderen Selbstverwaltungssystemen Hunderte Menschen täglich am Erhalt des Systems arbeiten, beschäftigt der DPR bundesweit acht. Pflegekompetenz fließe so kaum in politische Entscheidungsprozesse ein, obwohl sie in allen Versorgungsbereichen dringend gebraucht werde – von der Primärversorgung bis zur Public Health.
Ein pragmatischer Schritt: Der Deutsche Pflegerat hat in den letzten Monaten seine Strukturen geöffnet. Die beiden Pflegekammern sind inzwischen mit Stimmrecht eingebunden. Auch die Landespflegeräte arbeiten in einem neuen gemeinsamen Ausschuss mit.
Vogler sieht darin einen wichtigen Übergang hin zu einer bundesweiten, demokratisch legitimierten Selbstverwaltung der Pflege. Der DPR, ursprünglich als Dachverband der Verbände gegründet, entwickelt sich damit zunehmend zu einer politischen Repräsentanz der gesamten Profession.
Ihr Appell am Ende des Gesprächs ist eindringlich: Pflege muss sich selbst organisieren. Keine Regierung, kein Verband außerhalb der Profession werde die Autonomie von außen bringen.
„Wenn wir glauben, jemand anders bringt uns gute Bedingungen, irren wir uns.“
– Christine Vogler
Die Zukunft der Pflege liegt für Vogler in der gemeinsamen Verantwortung: in Verbänden, Kammern, Netzwerken. Jede Mitgliedschaft, jeder Beitrag stärke die Stimme der Profession – und damit die Möglichkeit, Pflegepolitik von innen heraus zu gestalten.
📬 Unser Newsletter bleibt kostenlos – dank über 280 Menschen, die unsere Arbeit bereits unterstützen.
Wenn du unsere Inhalte schätzt, dich inspiriert fühlst oder einfach gern dabei bist: Werde Teil der Übergabe 💛
Mit deiner Mitgliedschaft erhältst du exklusiven Zugang zu unseren Briefings und zu unserem Videokurs Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege
Dein Support macht es möglich, dass wir dieses Projekt weiterführen und ausbauen können 🙌 Danke, dass du Teil davon bist!
Nina Warken im Interview
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken betonte in ihrer Begrüßungsrede, dass Pflege zu lange nicht die Wertschätzung erhalten habe die ihr zusteht. Gleichzeitig betonte sie, dass die Löhne gestiegen seien und auch die gesellschaftliche Wertschätzung zugenommen habe. Sie dankte persönlich Christine Vogler dafür, ein Sprachrohr für die Pflegenden zu sein. Der DPR sei unverzichtbar und die Förderung durch das BGM werde fortgeführt. Sie betonte die Notwendigkeit pflegerische Forderungen zu einen und die Mitwirkung an Gesetzesvorhaben zu sichern. Ihre Rede schloss sie mit der Aussage, dass Pflege eine eigenständige Disziplin in der medizinischen Versorgung sei.
Nach ihrer Rede hatte sie Zeit für eine Frage unsererseits. Wir fragten, was sie bis Montag ändern wird für die Pflegenden in Deutschland und welche Beschlüsse und Herausforderungen am drängendsten sind. Ihre Antwort: Mit dem neuen Befugniserweiterungsgesetz erhalten Pflegefachpersonen bereits kurzfristig mehr Handlungsspielräume – etwa im Wundmanagement, der Demenzbetreuung und Diabetesvorsorge. Langfristig sollen Attraktivität des Berufs und Zukunftsfähigkeit der Pflegeversicherung gestärkt werden.
Community Health Nursing: Versorgung neu denken
Ein Highlight des Tages war das Gespräch mit Alexander und Oliver, die stellvertretend für das Team der Hamburger Gesundheitshäuser und Pflegepreisträgerin Cagla Kurtçu zu Gast bei uns im Podcast waren. Ihr Konzept steht exemplarisch für den Wandel der Versorgung: weg von der fragmentierten Einzelleistung, hin zu einem wohnortnahen, multiprofessionellen Ansatz.

In sozial benachteiligten Stadtteilen bieten sie niedrigschwellige Gesundheitsberatung, Prävention und Koordination – geleitet von Pflegefachpersonen mit akademischem Hintergrund. Die Community Health Nurses verstehen sich als Knotenpunkt zwischen Medizin, Pflege und Sozialraum. Durch kontinuierliche Begleitung, Aufklärung und Gesundheitskompetenzförderung entlasten sie nicht nur Ärzt:innen, sondern stärken die Selbstwirksamkeit der Menschen vor Ort.
Eine Evaluationsstudie aus dem Innovationsfonds zeigte, dass die Zahl ambulant-sensitiver Krankenhausfälle in der Modellregion um bis zu 90 Prozent gesenkt werden konnte – ein eindrucksvoller Beleg für den ökonomischen und gesundheitlichen Nutzen. Trotzdem bleibt die Finanzierung prekär: Nur die AOK Rheinland-Hamburg beteiligt sich bislang über Selektivverträge.
Ihre Forderung ist klar: eine langfristig abgesicherte, regelhafte Finanzierung, die den Mehrwert solcher Strukturen anerkennt. Gesundheitshäuser könnten so zu einer tragenden Säule im öffentlichen Gesundheitswesen werden.
Ernährung und Pflegepraxis: Innovationskraft aus der Station
Am Stand der BG-Kliniken stellten Ursula Wacker und Kerstin Heinz ein praxisnahes Projekt vor: das sogenannte „Q-Müsli“. Dahinter verbirgt sich eine gezielte Ernährungsintervention für querschnittgelähmte Patient:innen.
Im Zuge des interdisziplinären Case Managements wurde festgestellt, dass die bisherige Kost zu wenig Ballaststoffe enthielt und damit den Darmmanagement-Prozess erschwerte. Durch die Einführung des modifizierten Müslis mit abführenden Komponenten konnten Laxanzien reduziert und gleichzeitig die Lebensqualität der Patient:innen verbessert werden.
Das Beispiel zeigt, wie Pflegefachlichkeit aus der Praxis heraus therapeutische Wirkung entfalten kann – evidenzbasiert, ressourcenschonend und patientenzentriert.
Gesetzliche Befugniserweiterung: Pflege übernimmt Verantwortung
Zentraler Programmpunkt des Tages war die Präsentation des Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP). Heike Hoffer, Referatsleiterin im Bundesgesundheitsministerium, erläuterte die neuen Möglichkeiten: Pflegefachpersonen dürfen künftig selbstständig bestimmte Heilkunde-Maßnahmen durchführen – etwa Katheter legen oder Wundmanagement initiieren – ohne ärztliche Anordnung.
Damit wird erstmals gesetzlich anerkannt, dass Pflege nicht nur unterstützend, sondern heilkundlich tätig ist. Die Verantwortung soll künftig durch die Selbstverwaltung konkretisiert werden, also durch den GKV-Spitzenverband. Pflegeverbände sollen mitreden.
Ein zentraler Aspekt ist die Einführung pflegerischer Diagnosen. Sie bilden die Grundlage für eigenständige Entscheidungen und verdeutlichen, dass Pflege über ein eigenes professionelles Wissen verfügt. Der Begriff der „Befugniserweiterung“ ersetzt bewusst den Begriff „Kompetenzerweiterung“ – denn die Kompetenz ist längst vorhanden, sie erhält nun endlich rechtliche Geltung.
Akademisierung und Nachqualifizierung: Perspektiven der Hochschulen
Wie diese neuen Befugnisse umgesetzt und in Ausbildung und Studium integriert werden könnten, erläuterte Prof. Dr. Johannes Gräske, Vorsitzender der Bundesdekanenkonferenz Pflegewissenschaft. Er machte deutlich, dass die Pflegeausbildung in Deutschland noch stark heterogen ist – zwischen sechs- und achtsemestrigen Bachelorstudiengängen und uneinheitlichen Qualifikationsprofilen.
Gräske fordert klare Strukturen, um die Anschlussfähigkeit zum Master- und Advanced-Practice-Bereich sicherzustellen. Gleichzeitig warnte er vor einer Spaltung zwischen beruflich Qualifizierten und akademisch Ausgebildeten. Über Brückenkurse und Zertifikatsprogramme sollten auch bisherige Bachelor-Absolvent:innen oder beruflich ausgebildete Pflegefachpersonen die neuen heilkundlichen Kompetenzen erwerben können.
Die Bundesdekanenkonferenz plädiert dafür, die Akademisierung als inklusiven Prozess zu verstehen: nicht als Trennung, sondern als gemeinsame Weiterentwicklung der Profession.
Pflegewissenschaftliche Einordnung: Diagnosen als Sprache der Profession
Prof. Dr. Thomas Fischer von der Evangelischen Hochschule Dresden brachte eine wissenschaftliche Perspektive ein: Welche Diagnosesysteme eignen sich überhaupt für die Pflege? In Deutschland existiert bisher kein einheitlich etabliertes System. Genutzt werden teils NANDA-Diagnosen aus den USA oder European Nursing Care Pathways (ENP), doch beide sind nicht flächendeckend implementiert.
Fischer sieht in der Einführung pflegerischer Diagnosen eine Chance zur Professionalisierung – aber auch zur inhaltlichen Selbstverortung. Er plädiert dafür, über rein pflegerische Klassifikationen hinauszudenken und eventuell auch Teile der ICD-Systematik zu nutzen, etwa dort, wo Funktionsstörungen und Aktivitäten des täglichen Lebens beschrieben werden.
Damit könnte Pflege eine Brücke schlagen zwischen medizinischer und sozialer Diagnostik – und ihre eigene Expertise sichtbarer machen.
Disaster Nursing: Pflege in Krisen und Katastrophen
Ein weiterer Schwerpunkt des ersten Tages war das Gespräch mit Marie-Christine Petrasch, Community Health Nurse an den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick. Ihr Thema: Disaster Nursing, also die Pflege in Katastrophen- und Krisensituationen.
Sie erläuterte, dass Pflegefachpersonen bisher kaum auf solche Szenarien vorbereitet sind – weder strukturell noch curricular. Dabei zeigten Ereignisse wie die Flut im Ahrtal oder großflächige Stromausfälle, dass Pflege in Katastrophen oft die erste erreichbare Profession ist. Disaster Nursing befähigt Pflegende, in Krisen handlungssicher zu agieren, Versorgung zu organisieren und Bevölkerungsschutz mitzugestalten.
Fort- und Weiterbildungen existieren bereits in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz, doch Petrasch fordert, das Thema langfristig in die Grundausbildung und akademische Lehre zu integrieren. Katastrophenpflege sei keine Nische, sondern Teil einer modernen, resilienten Gesundheitsversorgung – gerade angesichts von Klimawandel, Pandemien und geopolitischen Krisen.
Berufspolitik in Bewegung: Pflegegrün will gestalten
Zum Abschluss des Tages sprach Kevin Galuszka, langjähriger Pflegefachmann, Wissenschaftler und Teil des Deutschen Pflegerats. Mit der Gründung des Vereins Pflegegrün setzt er gemeinsam mit Kolleg:innen ein deutliches Zeichen: Pflege will politisch mitreden – parteinah, aber unabhängig.
Pflegegrün versteht sich als Netzwerk für Menschen, die Pflegepolitik sichtbarer machen und innerhalb wie außerhalb der Partei Bündnis 90/Die Grünen an gesundheits- und sozialpolitischen Konzepten arbeiten möchten. Mitglied können alle werden, die sich für Pflege- und Berufspolitik engagieren wollen, unabhängig von Parteimitgliedschaft.
Die Initiative zeigt, dass Pflege sich zunehmend auch zivilgesellschaftlich organisiert, um Themen wie Arbeitsbedingungen, Akademisierung, Klimafolgen und Public Health aktiv zu gestalten. Der Pflegetag bot dafür die passende Bühne – als Ort der Begegnung und als Symbol einer Profession, die in Bewegung ist.
DPT - Tag 2
Der zweite Tag des Deutschen Pflegetags 2025 zeigte erneut, wie vielfältig und lebendig die Pflege in Deutschland ist. Zwischen Fachvorträgen, politischen Impulsen und spontanen Begegnungen entstand ein Bild einer Profession, die sich nicht nur weiterentwickeln, sondern auch positionieren will. Pflegefachpersonen, Wissenschaftler:innen, Politiker:innen und Aktivist:innen kamen zu Wort – mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber einem gemeinsamen Ziel: Pflege sichtbar, wirksam und zukunftsfähig zu machen.
Podcastkultur als Spiegel der Pflege
Den Auftakt machten Litti und Olschgich vom Podcast Zwischenschicht. Seit fünf Jahren gestalten sie ein Format, das pflegerische Realität und Unterhaltung miteinander verbindet. Der eine ist Krankenpfleger mit 25 Jahren Berufserfahrung, der andere Außenstehender – und genau dieses Spannungsverhältnis macht ihren Podcast so zugänglich.
Sie erzählen, wie sie mit einfachen Mitteln gestartet sind und über 200 Folgen hinweg eine beachtliche Community aufgebaut haben. Heute steht hinter der Zwischenschicht ein kleines Produktionsteam, und die Gespräche reichen von Berufspolitik bis zu Alltagsgeschichten aus der Pflegepraxis. Ihr Ansatz: Wissensvermittlung mit Leichtigkeit, aber ohne inhaltsleere Unterhaltung.
Gleichzeitig reflektieren sie kritisch die Entwicklung der Pflegepodcast-Landschaft. Während frühere Formate oft unprofessionell produziert waren, etabliert sich nun eine Szene, die journalistisch arbeitet und Themen bewusst setzt. Dass Pflegefachpersonen selbst Inhalte gestalten, gilt ihnen als Zeichen einer Profession, die ihre eigene Stimme erhebt – jenseits klassischer Medienlogiken.
Die beiden betonen zudem, wie wichtig Kooperation statt Konkurrenz ist: Pflege-Podcasts verstehen sich nicht als Wettbewerber, sondern als Teil einer gemeinsamen Bewegung. Dieser kollegiale Umgang, sagen sie, sei Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses – solidarisch, kritisch und lernbereit.
Weiterbildung zwischen Anspruch und Struktur
Ein inhaltlicher Schwerpunkt des zweiten Tages lag auf der akademischen Qualifizierung und der Rolle der Advanced Practice Nurses (APN).
Der Pflegewissenschaftler Dr. Peter Nydahl aus Kiel und Dr. Regina Wiedemann von der Fliedner Fachhochschule diskutierten die Frage, wie Weiterbildung und Studium künftig ineinandergreifen sollen.
Nydahl machte deutlich, dass der Bachelorabschluss in der Pflege mehr ist als ein akademischer Titel – er steht für wissenschaftlich fundierte, reflektierte Praxis. Doch die Profession müsse aufpassen, nicht zum „billigen Arztersatz“ zu werden, wenn neue Heilkunderechte eingeführt werden. Die Befugniserweiterung müsse die Pflege stärken, nicht instrumentalisieren.
Wiedemann stellte die ersten spezifischen Masterprogramme in Onkologie vor, die mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe entstehen. Ziel sei es, Fachweitergebildete über verkürzte Bachelorprogramme in klinische Masterstudiengänge zu führen. Damit soll ein durchlässiges System geschaffen werden, das Berufserfahrung und akademische Qualifikation verbindet.
Beide betonen, dass Deutschland klare, aber flexible Qualifikationsrahmen braucht: genug Homogenität, um Qualität zu sichern, aber auch Offenheit, um individuelle Laufbahnen zu ermöglichen. Entscheidend sei, dass pflegerische Expertise über Sektorengrenzen hinweg wirksam wird – in Kliniken, Praxen und der häuslichen Versorgung.
Zugleich wurde das Thema Finanzierung angesprochen: Wie lassen sich akademische Rollen in der Praxis verankern, wenn Budgets fehlen? Modelle reichen derzeit von tariflichen Zuschlägen bis zu Projektstellen. Eine bundesweite Regelung steht aus – und bleibt eine der zentralen Baustellen für die Profession.
Pflegepolitik zwischen Entbürokratisierung und Befugniserweiterung
Die neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler, sprach über ihre Rolle zwischen Politik und Praxis. Ihr Ziel: Pflegefachpersonen sollen endlich die Kompetenzen nutzen können, die sie längst haben. Das neue Gesetz zur Befugniserweiterung ist für sie ein wichtiger Schritt für Selbstverständnis und Attraktivität des Berufs.
Staffler betont, dass Digitalisierung und Entbürokratisierung zentrale Elemente einer modernen Pflegepolitik seien. Digitale Lösungen könnten Routineaufgaben verringern und Dokumentationspflichten vereinfachen – ein direkter Beitrag zur Arbeitsentlastung.
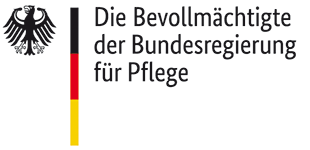
Auf die Frage nach Advanced Practice Nursing und Community Health Nursing verweist sie auf den politischen Fahrplan: Nach dem Pflegeassistenzgesetz und der Befugniserweiterung stehe als nächstes die gesetzliche Grundlage für APN an. Ihr Appell ist klar: Pflege braucht Gestaltungsspielräume, keine engen Grenzen.
Pädiatrische Pflege braucht Profil
Mit Brigitte Hauf, stellvertretende Vorsitzende des Berufsverbands Kinderkrankenpflege Deutschland (BeKD), wurde ein Thema aufgegriffen, das in der Generalistik-Debatte oft übersehen wird: die Zukunft der Kinderkrankenpflege.
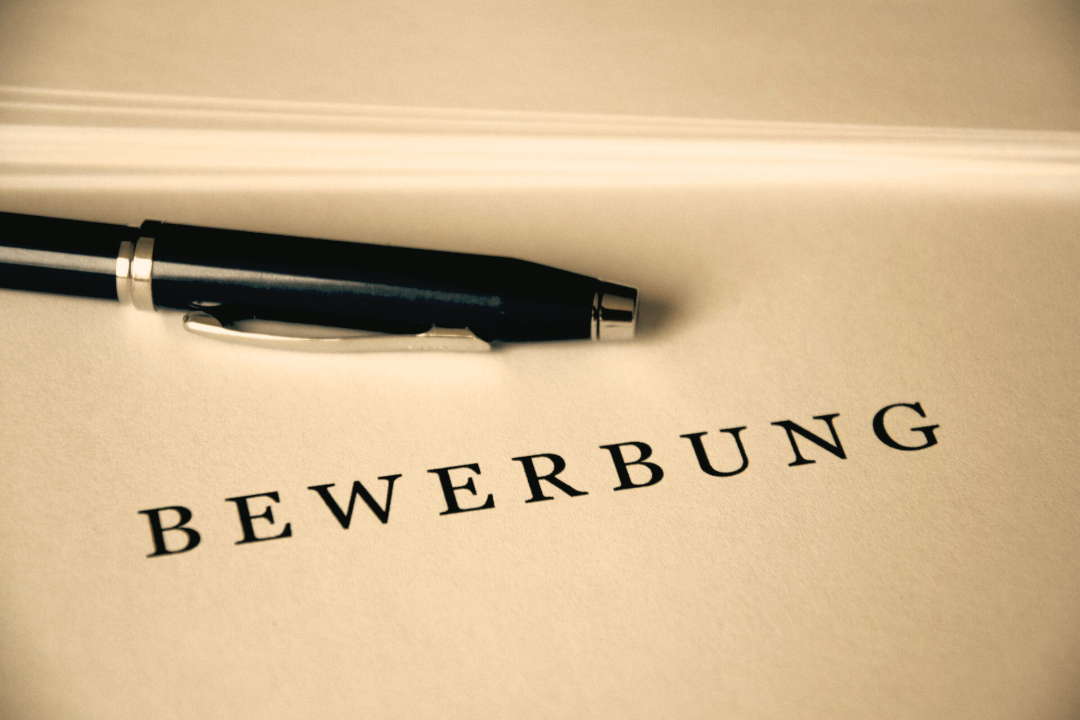
Ausgangspunkt war das neue Positionspapier des Deutschen Pflegerats zur Pflegebildung. Während dort über eine Abschaffung der Spezialisierungen nachgedacht wird, warnt der BeKD vor einem Verlust pädiatrischer Expertise. Nur ein Prozent der Absolvent:innen wählen den Schwerpunkt Kinderkrankenpflege – doch das, so Hauf, liege auch daran, dass viele Schulen das Wahlrecht gar nicht anbieten.
Die Konsequenz: Wenn der spezialisierte Berufsabschluss entfällt, droht eine Versorgungslücke bei schwerkranken Kindern. Hauf fordert daher eine bundeseinheitliche Anschlussqualifikation sowie den Ausbau spezialisierter Bachelor- und Masterprogramme, etwa in Advanced Practice Pädiatrie.
Ihr zentrales Argument: Kinder sind keine „kleinen Erwachsenen“. Wer Säuglinge mit 600 Gramm Geburtsgewicht oder beatmete Kinder betreut, braucht hochspezialisierte Kompetenzen – klinisch, kommunikativ und familienorientiert. Eine rein generalistische Ausbildung könne das nicht abbilden.
Prävention, ÖGD und Community Health
Auch die Politik der Länder war präsent: Katharina Schenk, Gesundheitsministerin Thüringens und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, sprach über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) als unterschätzte Säule des Systems.
Sie machte deutlich, dass Prävention mehr Aufmerksamkeit verdient. Gesundheitsförderung beginne, bevor Krankheit entsteht – und hier habe der ÖGD eine Schlüsselrolle, etwa in Kitas, Schulen oder kommunalen Projekten.
Schenk kritisierte, dass der ÖGD-Pakt des Bundes ausgelaufen ist und damit die finanzielle Unterstützung für Kommunen gefährde. Sie forderte, pflegerische Rollen stärker einzubinden – insbesondere Community Health Nurses, die Prävention, Versorgung und soziale Arbeit verbinden.
„Pflege ist kein Randthema, sondern Teil öffentlicher Daseinsvorsorge.“
– Katharina Schenk
In Bezug auf die Krankenhausreform betonte sie, dass Pflege bei der Diskussion um Personaluntergrenzen und Leistungsgruppen mitgedacht werden müsse. Heilung sei kein rein ärztlicher Prozess. Ohne Pflege gebe es keine Genesung, keine Qualität, keine wohnortnahe Versorgung.
Zugleich zeigte sie Verständnis für föderale Vielfalt: Thüringen plant zunächst ein Pflegeentwicklungsgesetz, bevor über eine Landespflegekammer entschieden wird. Pflegepolitik, so Schenk, müsse pragmatisch und partizipativ zugleich sein.
Pflege gegen Rechts
Einen starken gesellschaftspolitischen Akzent setzten Anja Wiedermann und Blendina Beqiri mit ihrer Initiative Pflege gegen Rechts.
Was als Onlinebewegung begann, ist heute ein wachsendes Netzwerk von Pflegefachpersonen, die sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus positionieren.
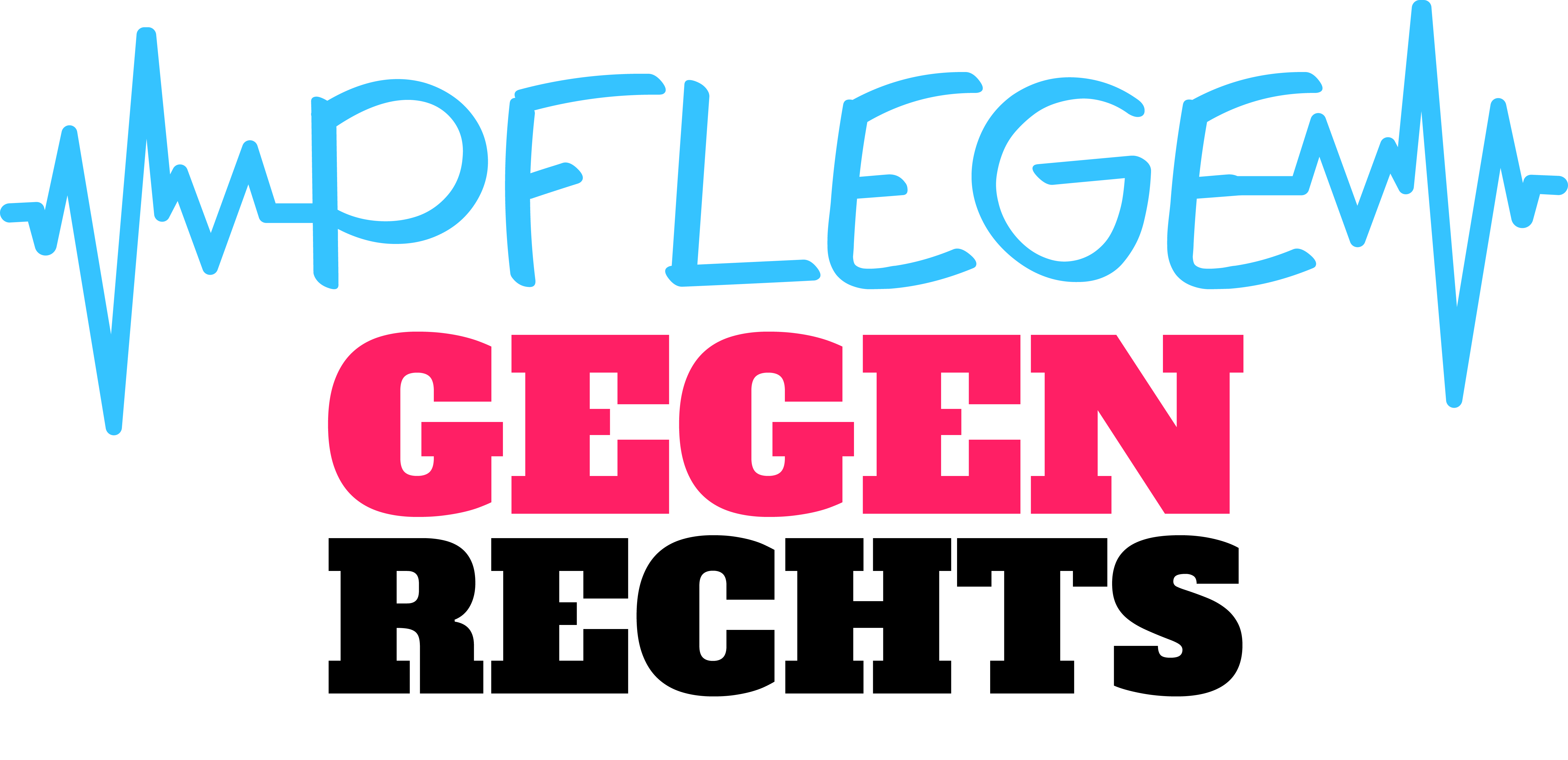
Ohne Satzung, ohne Hierarchien, aber mit klaren Werten vernetzen sie sich über soziale Medien, führen Live-Gespräche, teilen Erfahrungen aus der Praxis und schaffen einen sicheren Raum für Betroffene. Beqiri beschreibt, wie sich Rassismus im Pflegealltag zeigt – oft nicht laut, sondern subtil: durch Mikroaggressionen, strukturelle Barrieren oder „positive Vorurteile“, die trotzdem ausgrenzen.
„Wir müssen Haltung zeigen, auch wenn’s unbequem ist.“
- Blendina Beqiri
Wiedermann betont, dass Haltung zeigen Teil professioneller Verantwortung ist. Pflege gegen Rechts will stärken, vernetzen und dazu beitragen, dass Diskriminierung im Gesundheitswesen sichtbar gemacht wird.
Ihr Engagement zeigt, dass Pflege nicht nur ein Berufsfeld ist, sondern auch ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Wer Menschen pflegt, steht in Beziehung – und Beziehung braucht Respekt.
Berufsrecht, Weiterbildung und Verantwortung
Mit Sandra Postel, Präsidentin der Landespflegekammer Nordrhein-Westfalen, wird deutlich, wie weit die Profession auf Landesebene bereits gekommen ist – und welche Aufgaben noch bevorstehen.
Mit über 250.000 registrierten Mitgliedern ist die Pflegekammer NRW die größte heilberufliche Vertretung Deutschlands. Nach dem Aufbau organisatorischer Strukturen rückt nun die konkrete Gesetzes- und Berufsrechtsarbeit in den Mittelpunkt.
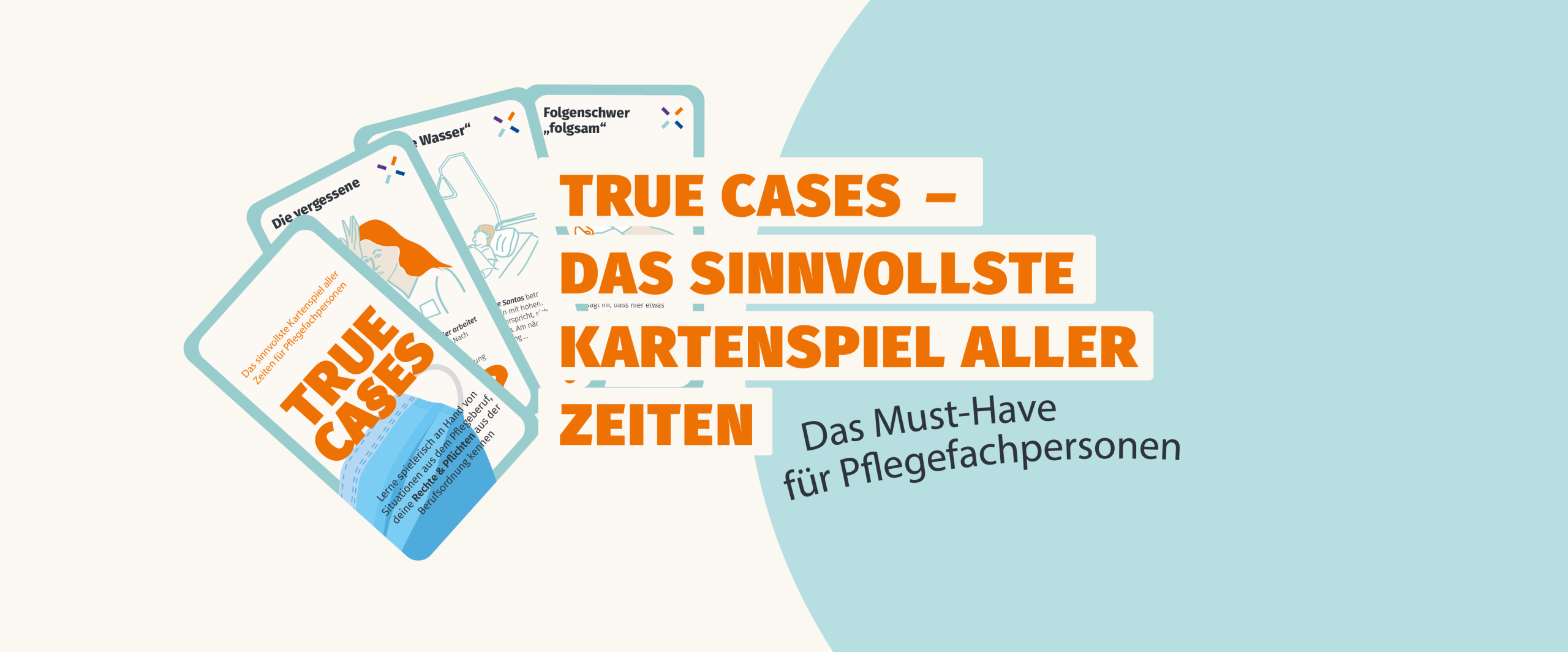
Zentrale Themen sind dabei die Berufsordnung und die Weiterbildungsordnung, die festlegen, was Pflege leisten darf und welche Qualifikationen verpflichtend sind. Besonders wichtig ist Postel die Abgrenzung pflegerischer Aufgaben: In aktuellen Gesetzesnovellen, etwa im Bereich der forensischen Psychiatrie, positioniert sich die Kammer klar – Transporte von Patient:innen sind keine pflegerische Tätigkeit, sondern zusätzliche Aufgaben, die nicht zur originären Profession gehören.

Darüber hinaus treibt die Kammer in NRW die Entwicklung einer handlungsfeldbezogenen Weiterbildungssystematik voran. Sie soll Pflegefachpersonen ermöglichen, nach der generalistischen Ausbildung in spezialisierte Bereiche einzusteigen – beispielsweise in der Pädiatrie. Damit reagiert die Kammer auf die Erkenntnis, dass Generalistik zwar Basiswissen schafft, aber Vertiefung und Spezialisierung notwendig bleiben.
Ein weiteres Ziel ist die Einführung einer Fortbildungsordnung, um lebenslanges Lernen verbindlich zu machen und die Refinanzierung von Weiterbildung dauerhaft zu sichern. Postel betont, dass regulierte Strukturen Sicherheit schaffen – für Pflegende wie für Arbeitgeber. Die Pflegekammer Rheinland-Pfalz, die diese Ordnung bereits eingeführt hat, gilt dabei als Vorbild.
„Wir müssen raus aus der Unregulierung, hin zu gesicherter Weiterbildung.“
– Sandra Postel
Auch die Zusammenarbeit zwischen den Kammern und anderen Institutionen ist enger geworden. Mit der Vereinigung der Pflegenden in Bayern und dem Deutschen Pflegerat besteht mittlerweile ein konstruktiver Austausch. Durch eine geänderte Satzung können Landespflegekammern künftig Mitglieder des Deutschen Pflegerats werden – ein Schritt, der die berufsrechtliche Perspektive auf Bundesebene stärkt.
Schließlich warnt Postel vor dem drohenden Versorgungsmangel in Nordrhein-Westfalen: Laut einer Kammererhebung werden in den kommenden Jahren rund 40 % der Pflegefachpersonen in Rente gehen. Die Kammer reagiert mit Beratung, Datenaufbereitung und kommunaler Vernetzung. Themen wie Quartiersentwicklung, Fachkräftegewinnung und Community Health Nursing stehen daher weit oben auf der Agenda.
Bis Februar 2026 soll ein Positionspapier entstehen, das festlegt, wie Advanced Practice Nurses und Community Health Nurses strukturell verankert werden können.
Postels Fazit ist klar: Pflege braucht politische Mitgestaltung, klare Berufsrechte und den Mut, sich selbst zu organisieren. Nur dann kann Pflege in der Versorgung, Bildung und Forschung langfristig Verantwortung übernehmen.
Junge Pflege zwischen Engagement und Empowerment
Im Gespräch mit Björn und Lara aus der Jungen Pflege im DBfK wird deutlich, wie stark die nächste Generation von Pflegefachpersonen bereits in berufspolitische Prozesse eingebunden ist.
Beide engagieren sich in den Lenkungsgruppen des Verbandes – Björn im Regionalverband Nordwest, Lara im Nordost – und waren federführend an der Organisation des Junge Pflege Kongresses beteiligt, der parallel zum Deutschen Pflegetag stattfand.

Mit internationaler Beteiligung, etwa durch den ICN-Präsidenten Howard Catton, wurde deutlich, dass Pflege längst Teil einer globalen Diskussion ist. Themen wie die neue Definition of Nursing und die internationale Vernetzung zeigen, dass junge Pflegefachpersonen ihr Berufsbild zunehmend als gesellschaftlich-politische Rolle verstehen.
Die Junge Pflege vertritt Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger:innen und bringt deren Perspektive in den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe ein. Besonders im Fokus steht die Qualität der Ausbildung. Eigene Umfragen zeigten, dass die Praxisanleitung oft nicht ausreichend umgesetzt wird und Auszubildende teils zum Personalausgleich herangezogen werden. Die Forderung: Ausbildung muss Lernraum bleiben – keine Lückenbüßerfunktion.
Darüber hinaus setzen sich die jungen Engagierten für Empowerment und berufspolitische Beteiligung ein. Lara berichtet, dass das Interesse an berufspolitischem Engagement spürbar wächst, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Je mehr junge Menschen sich beteiligen, desto stärker kann Pflege ihre Zukunft selbst gestalten.
Das Engagement der Jungen Pflege ist dabei nicht nur organisationsintern, sondern auch emotional verankert. Der Austausch mit erfahrenen Kolleg:innen auf dem Pflegetag wird als motivierend erlebt. Er zeigt, dass Pflegegenerationen voneinander lernen können – Erfahrung und Idealismus ergänzen sich.
Björn betont, dass Kongresse wie der Deutsche Pflegetag Motivation und Orientierung geben. Besonders inspirierend seien die Auftritte von Persönlichkeiten wie Christine Vogler, die in ihren Reden das Selbstbewusstsein und die Gestaltungsrolle der Pflege betone.
Für viele junge Pflegende steht fest: Pflege ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Bewegung – und wer Teil davon ist, kann etwas verändern.
Fazit
Der Deutsche Pflegetag 2025 zeigte eine Profession im Wandel. Pflegefachpersonen treten zunehmend als gestaltende Akteur:innen eines modernen Gesundheitswesens auf – wissenschaftlich fundiert, politisch vernetzt und praxisnah.
Die Gespräche machten deutlich, dass die Pflege in vielen Bereichen bereits Verantwortung übernimmt: in der Primärversorgung, in der Forschung, in der Katastrophenhilfe und in der politischen Interessenvertretung. Gleichzeitig bleibt der Weg zu struktureller Selbstbestimmung offen. Themen wie eine bundeseinheitliche Bildungsarchitektur, echte Handlungskompetenz und eine gesetzlich verankerte Selbstverwaltung sind weiterhin zentrale Aufgaben.
Beide Tage haben gezeigt, dass Pflege mehr ist als Versorgung – sie ist Expertise, Haltung und gesellschaftliche Relevanz. Der Pflegetag 2025 markiert dabei nicht nur eine Bestandsaufnahme, sondern einen Aufbruch: hin zu einer Pflege, die sich selbstbewusst in Verantwortung begibt und Zukunft aktiv mitgestaltet.
Wir danken dem Deutschen Pflegetag herzlich für die Einladung!
Solltest du Interesse daran haben, bei uns im Newsletter oder im Podcast zu werben oder eine Stellenanzeige zu schalten, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme per E-Mail: [email protected]













