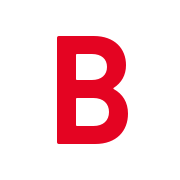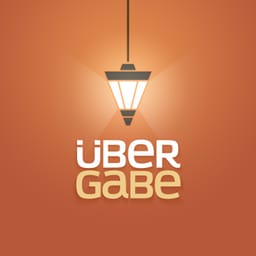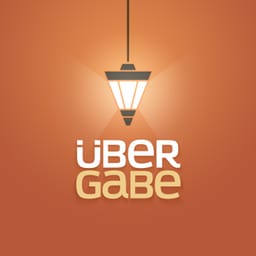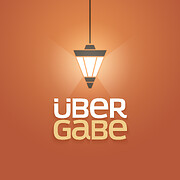Warum das Thema drängender wird
Die Pflege steht seit Jahren unter Druck. Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig, die Zahl der Pflegeplätze steigt, und gleichzeitig gehen viele Pflegefachpersonen in den Ruhestand. Der Fachkräftemangel ist längst keine Prognose mehr, sondern gelebte Realität. Um dieser Entwicklung zu begegnen, wird verstärkt auf die Anwerbung internationaler Pflegefachpersonen gesetzt.
In unserem Podcast haben wir dazu mit Debora Aust gesprochen. Sie ist Gründerin von DAREconsulting und Leiterin der Berliner Beratungsstelle für Fachkräfte mit ausländischem Pflegeabschluss (BBeFaP).
Sie begleitet seit vielen Jahren Pflegefachpersonen und berät Einrichtungen, die internationale Kolleg:innen beschäftigen. Ihre Erfahrungen zeigen eindrücklich, welche Chancen und Schwierigkeiten mit der Integration verbunden sind.


Dieser Podcast ist der zweite Teil einer Serie, die durch die Senatsverwaltung Wissenschaft, Gesundheit und Pflege Berlin gefördert wird. Den ersten Teil findest du hier:

Erwartungen und Hoffnungen
Für viele internationale Pflegefachpersonen ist die Entscheidung, zu uns zu kommen, ein biografischer Einschnitt. Häufig stehen dabei klare Erwartungen im Vordergrund: ein sicherer Arbeitsplatz, bessere Bezahlung, die Chance auf Karriere und die Hoffnung, der Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.
„Am Anfang wird man sehr unterstützt, um überhaupt nach Deutschland zu kommen. Aber sobald man hier ist, fühlt man sich völlig alleingelassen.“
Gerade Kolleg:innen aus Brasilien, Mexiko oder den Philippinen berichten, dass sie sich stabile Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten erhoffen. Für manche ist die Migration verbunden mit dem Traum, Spezialisierungen zu machen, vielleicht sogar Leitungsposten zu übernehmen. Für andere steht das Einkommen im Vordergrund, das in den Herkunftsländern oft weit niedriger ist.
Doch die Realität nach der Ankunft zeigt, dass sich diese Erwartungen häufig nicht erfüllen. Sprachbarrieren, fehlende Transparenz und unklare Karrierewege lassen die anfängliche Euphorie schnell schwinden.
Der erste Schritt: Anerkennung und Bürokratie
Zentral für die Integration ist das Anerkennungsverfahren. Ohne offizielle Bestätigung der Qualifikation ist eine Tätigkeit als Pflegefachperson nicht möglich. Zuständig sind die Landesbehörden, in Berlin etwa das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo).
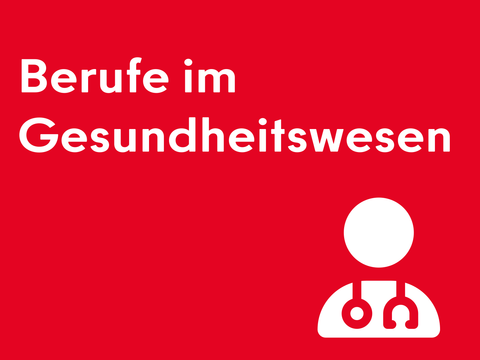
Formal ist das Verfahren eindeutig: Ausbildungsnachweise und Zeugnisse müssen eingereicht, Sprachkenntnisse nachgewiesen und Dokumente übersetzt werden. Doch in der Praxis erweist sich dieser Prozess als langwierig und komplex. Viele internationale Fachkräfte berichten von Überforderung, fehlenden Informationen und langen Wartezeiten.
Hinzu kommt, dass selbst nach der Anerkennung Unsicherheiten bleiben. Oft werden internationale Pflegefachpersonen zunächst nur als Pflegehilfskräfte eingesetzt – nicht selten aus Unsicherheit über ihre tatsächlichen Kompetenzen oder wegen fehlender Sprachprüfung. Für Menschen, die im Herkunftsland ein Studium absolviert oder in hochspezialisierten Bereichen gearbeitet haben, ist das ein schmerzlicher Rückschritt.
Sprache als Schlüssel und Stolperstein
Kaum ein Thema wird so häufig genannt wie die Sprache. Für die Berufserlaubnis ist das Niveau B2 vorgeschrieben, doch dieses Zertifikat sagt wenig darüber aus, wie sicher jemand im Pflegealltag kommuniziert.
Die Fachsprache unterscheidet sich stark vom Alltagsdeutsch. Dokumentationen, Abkürzungen, medizinische Fachbegriffe und rechtliche Formulierungen stellen eine zusätzliche Hürde dar. Viele internationale Fachkräfte berichten, dass Präsenz-Sprachkurse weitaus hilfreicher sind als Online-Angebote. Vor Ort entstehen soziale Kontakte, die Integration erleichtern und den Austausch fördern.
Sprache ist damit nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Schlüssel zur Zugehörigkeit. Wer nicht flüssig sprechen kann, wird schnell unterschätzt – unabhängig von den tatsächlichen fachlichen Kompetenzen.
Fehlende Transparenz als unerwartete Realität
Ein gravierendes Problem ist die Intransparenz bei der Vermittlung. Viele Pflegefachpersonen wissen im Vorfeld nicht, in welchem Bereich sie eingesetzt werden. So kommt es vor, dass eine Pflegefachperson aus Indien, die im Herkunftsland auf einer Intensivstation gearbeitet hat, plötzlich in einer Altenpflegeeinrichtung eingesetzt wird.
Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität ist enorm. Während internationale Fachpersonen eine Karriere in spezialisierten Kliniken erwarten, landen sie oft in der Grundpflege. Diese Zuweisung ist nicht nur enttäuschend, sondern führt häufig zu Frustration, innerer Kündigung und hoher Fluktuation.
Soziale Integration: Zwischen Unterstützung und Isolation
In den ersten Wochen erhalten viele internationale Fachkräfte noch Unterstützung. Arbeitgeber:innen helfen bei Visa, Einreise oder Wohnungssuche. Doch sobald sie hier angekommen sind, fühlen sich viele allein gelassen.
„Wir müssen weg von der Konkurrenz hin zu der Frage: Wie können wir unsere Kompetenzen bestmöglich nutzen?“
Eine brasilianische Kollegin formulierte es so: „Am Anfang wird man sehr unterstützt, um überhaupt nach Deutschland zu kommen. Aber sobald man hier ist, fühlt man sich völlig alleingelassen.“
Für die einen bedeutet das Einsamkeit, weil Partner:in und Kinder im Herkunftsland bleiben. Für andere heißt es, Familie, Kinder und neuen Beruf gleichzeitig zu organisieren. In beiden Fällen entstehen hohe Belastungen. Nicht selten führen sie zu psychischen Problemen, Heimweh und schließlich zur Rückkehr in das Heimatland.
Ein Lernprozess für alle Seiten
Integration ist keine Einbahnstraße. Sie gelingt nur, wenn sowohl internationale Pflegefachpersonen als auch deutsche Teams lernen, kulturelle Unterschiede zu verstehen.
In vielen Herkunftsländern wird die Grundpflege von Familienangehörigen übernommen. Pflegefachpersonen konzentrieren sich dort stärker auf medizinische Tätigkeiten. Bei uns dagegen gehört die Grundpflege zu den Kernaufgaben professioneller Pflege. Für internationale Kolleg:innen bedeutet das, dass sie Tätigkeiten übernehmen sollen, die in ihrem Herkunftsland nicht Teil ihres Berufsbildes waren. Für deutsche Teams wirkt es umgekehrt so, als seien die neuen Kolleg:innen nicht willig oder nicht qualifiziert.
Solche Missverständnisse entstehen nicht aus bösem Willen, sondern aus Unkenntnis. Interkulturelle Kompetenz heißt deshalb, Kommunikationsstile, Ausbildungssysteme und kulturelle Werte zu kennen – und Missverständnisse als Lernchance zu begreifen.
Diese Kompetenz müssen alle Beteiligten erwerben. Sie ist nicht angeboren, sondern ein Prozess, der trainiert werden muss. Schulungen, Rollenspiele und Reflexionsübungen können helfen. Einrichtungen sollten interkulturelle Trainings so selbstverständlich etablieren wie Arbeitsschutzunterweisungen.
Die Rolle der Führung: Klima der Vielfalt schaffen
Besonders wichtig ist das Engagement von Führungspersonen. Sie setzen den Ton, ob Vielfalt als Bereicherung oder als Belastung verstanden wird. Ein Beispiel aus Hamburg zeigt, wie es gehen kann: In einem Krankenhaus fand ein verpflichtender Fortbildungstag für alle Leitungspersonen statt, bei dem es ausschließlich um interkulturelle Kompetenz ging. Damit wurde deutlich gemacht, dass Integration kein Randthema ist, sondern eine Kernaufgabe professioneller Personalführung.
Führungskräfte müssen Erwartungen transparent machen, Karrierewege aufzeigen und individuelle Kompetenzen fördern. Wer frühzeitig Strukturen für Einarbeitung, Mentoring und soziale Begleitung schafft, legt die Grundlage dafür, dass internationale Pflegefachpersonen langfristig bleiben.
Potenziale nutzen statt verschenken
Ein zentraler Grund für die Migration ist die Aussicht auf Weiterentwicklung. Viele internationale Pflegefachpersonen wollen Praxisanleiter:innen werden, eine Leitungsfunktion übernehmen oder ihre Kompetenzen in spezialisierten Bereichen einbringen.
Doch es fehlt an klaren Strukturen. Unklare Weiterbildungswege, Sprachhürden und starre Hierarchien verhindern oft, dass vorhandenes Potenzial genutzt wird. Die Folge: Hochqualifizierte Fachkräfte bleiben in Positionen, die weit unter ihrem Niveau liegen. Für das deutsche Gesundheitssystem bedeutet das nicht nur einen Verlust an Motivation, sondern auch den Verlust dringend benötigter Fachkompetenz.
Subtile Diskriminierung und Vorurteile
Nicht immer sind es offene Ablehnungen, die die Integration erschweren. Häufig handelt es sich um subtile Formen von Diskriminierung. Eine Pflegefachperson von den Philippinen schilderte, dass sie häufig langsam und überdeutlich angesprochen werde – als könne sie nicht verstehen oder sei weniger intelligent.
Solche Erfahrungen zeigen, wie stark unbewusste Vorurteile wirken. Sie sind selten absichtlich, doch sie entmutigen und erschweren das Ankommen. Entscheidend ist daher, dass Teams lernen, ihre eigenen Bias zu reflektieren und Kompetenzen nicht allein an der Sprache zu messen.
Was wir lernen können
Andere Länder sind bei der Integration internationaler Fachkräfte weiter. Großbritannien setzt seit Jahrzehnten auf Pflegefachpersonen aus dem Ausland und hat strukturierte Mentoring-Programme etabliert. Skandinavische Länder investieren stark in Willkommensprogramme, die berufliche und soziale Integration verbinden. Kanada wiederum setzt auf community-basierte Netzwerke, die neue Fachkräfte nicht nur beruflich, sondern auch privat begleiten.
Wir können von diesen Modellen lernen. Transparenz, soziale Begleitung und die gezielte Nutzung vorhandener Kompetenzen sind zentrale Erfolgsfaktoren, die hierzulande noch zu oft fehlen.
Politische Verantwortung und ethische Fragen
Die Anwerbung internationaler Pflegefachpersonen ist nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine ethische Frage. Länder wie die Philippinen oder Indien verlieren durch Migration einen Teil ihrer ausgebildeten Fachkräfte – ein klassischer Brain Drain. Wir müssen deshalb auf faire Partnerschaften achten.
Das Gütesiegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist freiwillig. Verbindliche Standards fehlen, und damit bleibt das Risiko von Ausbeutung bestehen. Entscheidend ist, dass Anwerbung nachhaltig gestaltet wird – mit klaren Strukturen, die nicht nur die Einreise, sondern auch die langfristige Integration sichern.

Fazit
Die Rekrutierung internationaler Pflegefachpersonen ist unverzichtbar für die Zukunft der Pflege. Doch der Erfolg hängt nicht allein von Sprachkursen oder Anerkennungsverfahren ab. Entscheidend sind Transparenz, klare Karrierewege, soziale Begleitung und die Fähigkeit, Vielfalt als Stärke zu begreifen.
Integration ist keine Bringschuld, sondern eine gemeinsame Aufgabe. Wenn Einrichtungen die Kompetenzen internationaler Pflegefachpersonen anerkennen, fördern und wertschätzen, profitieren nicht nur die Fachpersonen selbst, sondern auch Patient:innen, Teams und das gesamte Gesundheitssystem.
Podcast in englischer Sprache
Podcast in spanischer Sprache
Neu: Unser erster Videokurs ist da! 🚀
Wir haben endlich unseren ersten Videokurs veröffentlicht – und das Thema könnte kaum spannender sein: Pflegeforschung.
Darin zeigen wir dir Schritt für Schritt:
- was Pflegeforschung eigentlich ist,
- wie du aus einer Idee eine präzise Forschungsfrage entwickelst und
- wie du gezielt gute Literatur findest.
Die Lektionen sind kurz und verständlich aufgebaut – perfekt für Einsteiger:innen, die sicher in die Pflegeforschung starten wollen.
👉 Übergabe-Mitglieder erhalten exklusiv unbegrenzten Zugriff auf den gesamten Kurs.
Schau gern mal rein und sag uns, was du denkst – dein Feedback ist uns wichtig! 🎉
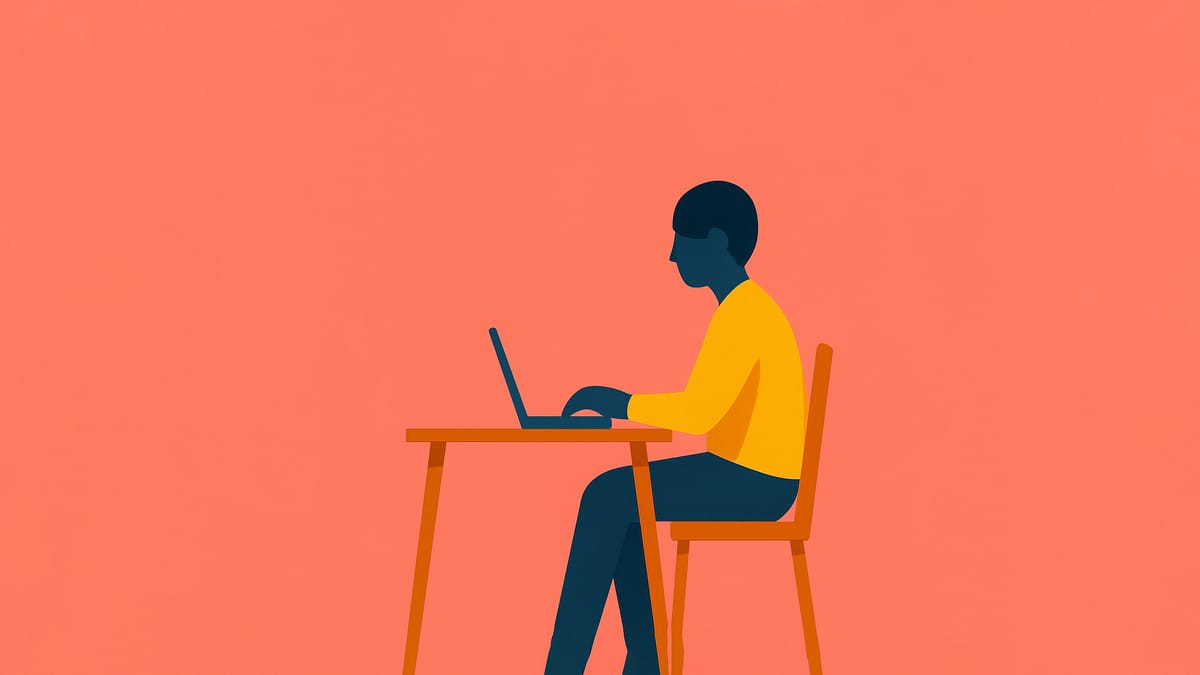
Übergabe Community-Board
Wir laden dich ein, dich auch in unserem Community-Board zu beteiligen. Hier findest du Pflegende aus allen Settings mit verschiedenster Qualifikation. Wir freuen uns, wenn du deine Themen dort mit allen diskutierst.

🚀 Mit der Übergabe-Mitgliedschaft erhältst du jede Woche ein Briefing per Mail, Zugang zum gesamten Archiv und du unterstützt ein unabhängiges Pflegeprojekt. Das ist mehr als ein Abo.