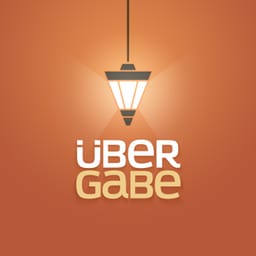Was bedeutet Elderspeak?
Elderspeak bezeichnet eine Überanpassung der Sprache, die auf Altersstereotypen basiert. Pflegefachpersonen gehen dabei unausgesprochen davon aus, dass ältere Patient:innen komplexe Sprache nicht verstehen können. Das Resultat: vereinfachte Satzstrukturen, Verniedlichungen, übertriebene Lautstärke oder ein kollektives „Wir“ – etwa in Sätzen wie: „Na, wollen wir uns mal waschen?“
Forschende unterscheiden dabei drei Ebenen:
- Verbale Ebene: Kosenamen, Verniedlichungen, vereinfachte Satzfragmente, Suggestivfragen oder Imperative.
- Paralinguistische Ebene: übertriebene Lautstärke, überhöhte Tonlage, betonte Aussprache.
- Nonverbale Ebene: Augenrollen, Kopfschütteln oder ein dominantes Raumverhalten.
Was zunächst harmlos wirkt, ist mehr als ein sprachlicher Tick. Elderspeak transportiert implizit eine Haltung – nämlich die Vorstellung, ältere Menschen seien automatisch weniger kompetent. Damit handelt es sich nicht nur um eine Kommunikationsform, sondern um eine Form subtiler Altersdiskriminierung.
Vom Alltagsmuster zum Forschungsthema
Schon in den 1980er Jahren wurde Elderspeak erstmals wissenschaftlich beschrieben – zunächst in den USA. Dort zeigten Studien, dass Pflegefachpersonen mit älteren Bewohner:innen anders sprachen als mit Kolleg:innen. Erst später erhielt das Phänomen den Namen Elderspeak und wurde systematisch untersucht.
Internationale Beobachtungsstudien machten das Ausmaß sichtbar: In einer Untersuchung wurden Pflegeinteraktionen während kompletter Schichten aufgezeichnet. Hierbei traten Elderspeak-Elemente auffällig häufig auf. In einer anderen Studie nutzten Pflegende Verniedlichungen oder Kosenamen.
In Deutschland hingegen steckt die Forschung noch in den Anfängen. Nur wenige Studien haben sich bislang mit Elderspeak befasst, und diese konzentrieren sich vor allem auf die Akutpflege. Umso wichtiger sind Projekte, die das Thema für den deutschsprachigen Raum erschließen.
📬 Unser Newsletter bleibt kostenlos – dank über 260 Menschen, die unsere Arbeit bereits unterstützen.
Wenn du unsere Inhalte schätzt, dich inspiriert fühlst oder einfach gern dabei bist: Werde Teil der Übergabe 💛
Mit deiner Mitgliedschaft erhältst du exklusiven Zugang zu unseren Briefings – etwa zum Thema Gibt es Altersdiskriminierung in der Pflege? – und zu unserem Videokurs Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege
Dein Support macht es möglich, dass wir dieses Projekt weiterführen und ausbauen können 🙌 Danke, dass du Teil davon bist!
Warum Elderspeak problematisch ist
Elderspeak ist keine harmlose Form der Kommunikation, sondern kann erhebliche Auswirkungen auf Patient:innen haben:
- Erlernte Hilflosigkeit: Wenn Menschen ständig bevormundet angesprochen werden, geben sie Eigeninitiative leichter auf.
- Verlust von Autonomie: Sprache kann den Eindruck verstärken, keine Kontrolle über die Situation zu haben.
- Psychische Belastung: Elderspeak fördert Gefühle von Isolation, Abhängigkeit und vermindertem Selbstwert.
- Negative Versorgungsergebnisse: Studien zeigen Zusammenhänge mit längerer Liegedauer im Krankenhaus, herausforderndem Verhalten bei Demenz und Ablehnung von Pflegemaßnahmen.
- Auswirkungen auf Pflegende selbst: Wer Elderspeak verwendet, wird von Außenstehenden – etwa Angehörigen – oft als weniger kompetent wahrgenommen.
Besonders deutlich zeigt sich die Problematik bei Menschen mit Demenz: Auch wenn sprachliche Fähigkeiten abnehmen, bleibt das Gespür für Haltungen und Respekt erhalten. Verniedlichende oder herablassende Sprache kann deshalb unmittelbar herausforderndes Verhalten auslösen.
„Sprache kann zur Isolation und einem Abhängigkeitsgefühl beitragen.“ - Annemarie Röthig
Zwischen Anpassung und Überanpassung
Nicht jede sprachliche Anpassung ist gleich Elderspeak. Es macht selbstverständlich Sinn, lauter oder langsamer zu sprechen, wenn ein Hörgerät fehlt oder eine Patientin schwerhörig ist. Entscheidend ist der Unterschied zwischen situationsbezogener Anpassung und übergriffiger Überanpassung.
„Je mehr wir uns mit Elderspeak beschäftigt haben, desto öfter haben wir es bei uns selbst erkannt.“ - Annemarie Röthig und Christina Hoffmann
Während eine Anpassung auf beobachtbare Bedürfnisse reagiert, basiert Elderspeak auf pauschalen Vorannahmen: Altsein wird mit Kranksein oder kognitiver Einschränkung gleichgesetzt. Die Folge: Sprache wird nicht auf die Person, sondern auf ein Stereotyp zugeschnitten.
Ob Elderspeak häufiger in bestimmten Bereichen auftritt, war lange unklar. Inzwischen deuten Ergebnisse darauf hin, dass die Langzeitpflege stärker betroffen ist als die Akutversorgung. Gründe dafür könnten die enge und langfristige Beziehung zwischen Pflegefachpersonen und Bewohner:innen sowie das strukturelle Abhängigkeitsverhältnis sein.
Auch Unterschiede zwischen Berufsgruppen zeichnen sich ab: Altenpfleger:innen und Pflegehelfer:innen neigen eher zu Verniedlichungen und Kosenamen als Kolleg:innen aus anderen Bereichen. Diese Beobachtungen legen nahe, dass nicht nur Alter oder Erfahrung, sondern auch Ausbildungskultur und Arbeitsumfeld eine Rolle spielen.
Der erste deutsche Fragebogen
Um Elderspeak messbar zu machen, haben drei Pflegewissenschaftlerinnen – Annemarie Röthig, Christina Hoffmann und Maria Schollmeyer – im Rahmen ihres Masterstudiums einen Fragebogen entwickelt.
Der Weg dorthin war aufwendig:
- Literaturrecherche: 81 internationale Studien wurden ausgewertet, um relevante Kommunikationsmuster zu identifizieren.
- Item-Generierung: Aussagen zu Elderspeak wurden formuliert, etwa zur Verwendung von Kosenamen oder vereinfachten Satzstrukturen.
- Expert:innen-Workshops: Fachleute aus Pflege, Gerontologie und Linguistik bewerteten die Items auf Relevanz.
- Validierung: Mit dem Content Validity Index wurde geprüft, ob die Items das Phänomen tatsächlich abbilden.
Das Ergebnis: ein Fragebogen mit zunächst 13 Items, davon 9 zu Elderspeak und 4 zur personenzentrierten Kommunikation.
Christina Hoffmann führte das Projekt in ihrer Masterarbeit weiter. Sie testete den Fragebogen an einer beeindruckend großen Stichprobe von 779 Teilnehmenden. Durch Faktorenanalysen konnten vier Dimensionen identifiziert werden:
- Syntax (vereinfachte Satzstrukturen)
- Diminutive (Verniedlichungen und Kosenamen)
- Paralinguistik (lauter oder langsamer sprechen)
- Personenzentrierte Kommunikation (als positive Gegenkategorie)
Der finale Fragebogen umfasst nun zehn Items und gilt als praxistauglich. Er erlaubt, Elderspeak in Studien und in der Versorgungspraxis systematisch zu erfassen. Die Masterarbeit ist jedoch noch nicht veröffentlicht.

Warum das wichtig ist
Ohne Instrumente bleibt Elderspeak ein schwer greifbares Phänomen. Mit einem validierten Fragebogen können künftig belastbare Daten erhoben werden:
- Wie verbreitet ist Elderspeak tatsächlich?
- Welche Situationen begünstigen ihn?
- Welche Auswirkungen haben Schulungen oder Leitbilder?
Die Antworten auf diese Fragen sind wichtig, um konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Dabei geht es von Ausbildungsinhalten über Fortbildungen bis hin zu Leitlinien für eine respektvolle Kommunikation.
Spannend ist auch die kulturelle Dimension: In Ländern wie Norwegen gibt es kein formelles „Sie“, alle Menschen werden geduzt. Dennoch existiert Elderspeak dort ebenfalls – ein Hinweis darauf, dass es nicht allein um Grammatik, sondern vor allem um Haltung geht.
Für eine internationale Anwendung müsste der Fragebogen jeweils kulturell angepasst werden. Gleichzeitig zeigt der internationale Vergleich: Elderspeak ist kein deutsches Problem, sondern ein global verbreitetes Phänomen.
Ansätze zur Veränderung
Die Forschung macht deutlich: Elderspeak ist tief in Alltagsroutinen verankert. Veränderung braucht deshalb Zeit und mehrere Ebenen:
- Ausbildung: Schon in der Pflegeausbildung sollte reflektiert werden, wie Sprache wirkt und wie Machtverhältnisse sprachlich transportiert werden.
- Praxis: Pflegefachpersonen sollten ermutigt werden, ihr Kommunikationsverhalten regelmäßig zu hinterfragen.
- Fortbildungen: In den USA existiert bereits ein Programm namens Changing Talk Intervention. Es sensibilisiert Pflegende durch Videos realer Situationen und zeigt Alternativen auf. In Deutschland fehlt bislang ein vergleichbares Angebot.
- Leitbilder und Führung: Einrichtungen, die personenzentrierte Kommunikation als festen Bestandteil ihrer Kultur verankern, können ein deutliches Signal setzen.
Wer sich mit Elderspeak beschäftigt, beschreibt oft denselben Effekt: Plötzlich hört man es überall – bei Kolleg:innen, aber auch bei sich selbst. Der erste Schritt zur Veränderung ist deshalb Selbstreflexion. Sprache ist kein neutrales Werkzeug, sondern prägt, wie Beziehungen entstehen und wie Menschen ihre Rolle in der Versorgung wahrnehmen.
„Es ist ein Prozess, der Zeit braucht – aber schon kleine Veränderungen im Sprachgebrauch können viel bewirken.“ - Christina Hoffmann
Fazit
Elderspeak ist mehr als eine sprachliche Eigenheit. Es ist ein Spiegelbild von Altersstereotypen, die sich in der Pflege eingeschlichen haben. Die Folgen reichen von vermindertem Selbstwertgefühl über herausforderndes Verhalten bis hin zu längeren Krankenhausaufenthalten.
Dank der Arbeit engagierter Pflegewissenschaftler:innen gibt es nun erstmals ein Instrument, um Elderspeak in Deutschland systematisch zu erfassen. Damit wächst die Chance, gezielt gegenzusteuern – durch Aufklärung, Ausbildung und Fortbildung.
Die zentrale Botschaft lautet: Sprache ist Macht. Wer ältere Patient:innen respektvoll und personenzentriert anspricht, trägt nicht nur zu ihrem Wohlbefinden bei, sondern stärkt auch die eigene professionelle Haltung.
Weiterführende Literatur
- Ausserhofer, D., Gnass, I., Meyer, G., & Schwendimann, R. (2012). Die Bestimmung der Inhaltsvalidität anhand des Content Validity Index am Beispiel eines Instruments zur Erfassung des Sicherheitsklimas im Krankenhaus.
- Beckstead, J. W. (2009). Content validity is naught. International Journal of Nursing Studies, 46(9), 1274–1283. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.04.014
- Hoffmann, C., Röthig, A., Schollmeyer, M., Meyer, G., & Beutner, K. (2025). Elderspeak im akutstationären Setting (EldAS). Pflege & Gesellschaft, 3/2025.
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. Nursing Research, 35(6), 382–385. https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health, 29(5), 489–497. https://doi.org/10.1002/nur.20147
- Schnabel, E. L., Wahl, H. W., Schönstein, A., Frey, L., & Draeger, L. (2020). Nurses’ emotional tone toward older inpatients: Do cognitive impairment and acute hospital setting matter? European Journal of Ageing, 17(3), 371–381. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00531-z
- Schnabel, E. L., Wahl, H. W., Streib, C., & Schmidt, T. (2021). Elderspeak in acute hospitals? The role of context, cognitive and functional impairment. Research on Aging, 43(9–10), 416–427. https://doi.org/10.1177/0164027520938986
- Shaw, C. A., & Gordon, J. K. (2021). Understanding elderspeak: An evolutionary concept analysis. Innovation in Aging, 5(3), igab023. https://doi.org/10.1093/geroni/igab023
- Waltz, C. F., & Bausell, B. R. (1981). Nursing research: Design statistics and computer analysis. Davis Fa.
Neu: Unser erster Videokurs ist da! 🚀
Wir haben endlich unseren ersten Videokurs veröffentlicht – und das Thema könnte kaum spannender sein: Pflegeforschung.
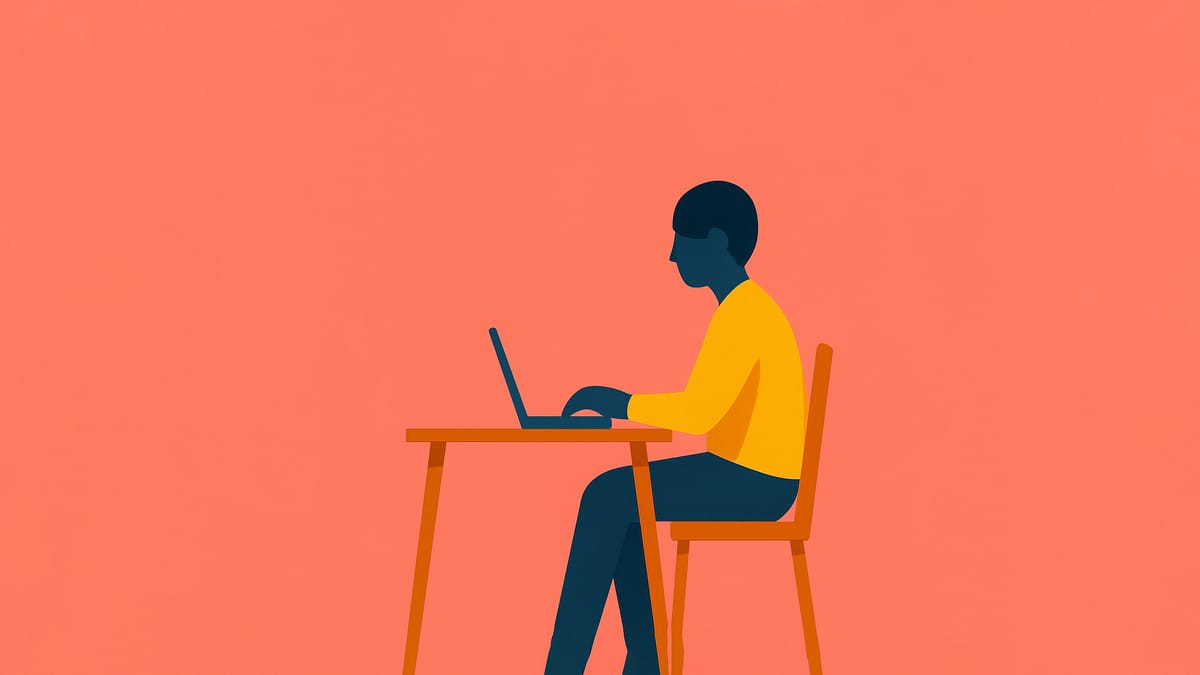
Darin zeigen wir dir Schritt für Schritt:
- was Pflegeforschung eigentlich ist,
- wie du aus einer Idee eine präzise Forschungsfrage entwickelst und
- wie du gezielt gute Literatur findest.
Die Lektionen sind kurz und verständlich aufgebaut – perfekt für Einsteiger:innen, die sicher in die Pflegeforschung starten wollen.
👉 Übergabe-Mitglieder erhalten exklusiv unbegrenzten Zugriff auf den gesamten Kurs.
Diskutier mit professionell Pflegenden in unserem Forum!

Solltest du Interesse daran haben, bei uns im Newsletter oder im Podcast zu werben oder eine Stellenanzeige zu schalten, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme per E-Mail: [email protected]