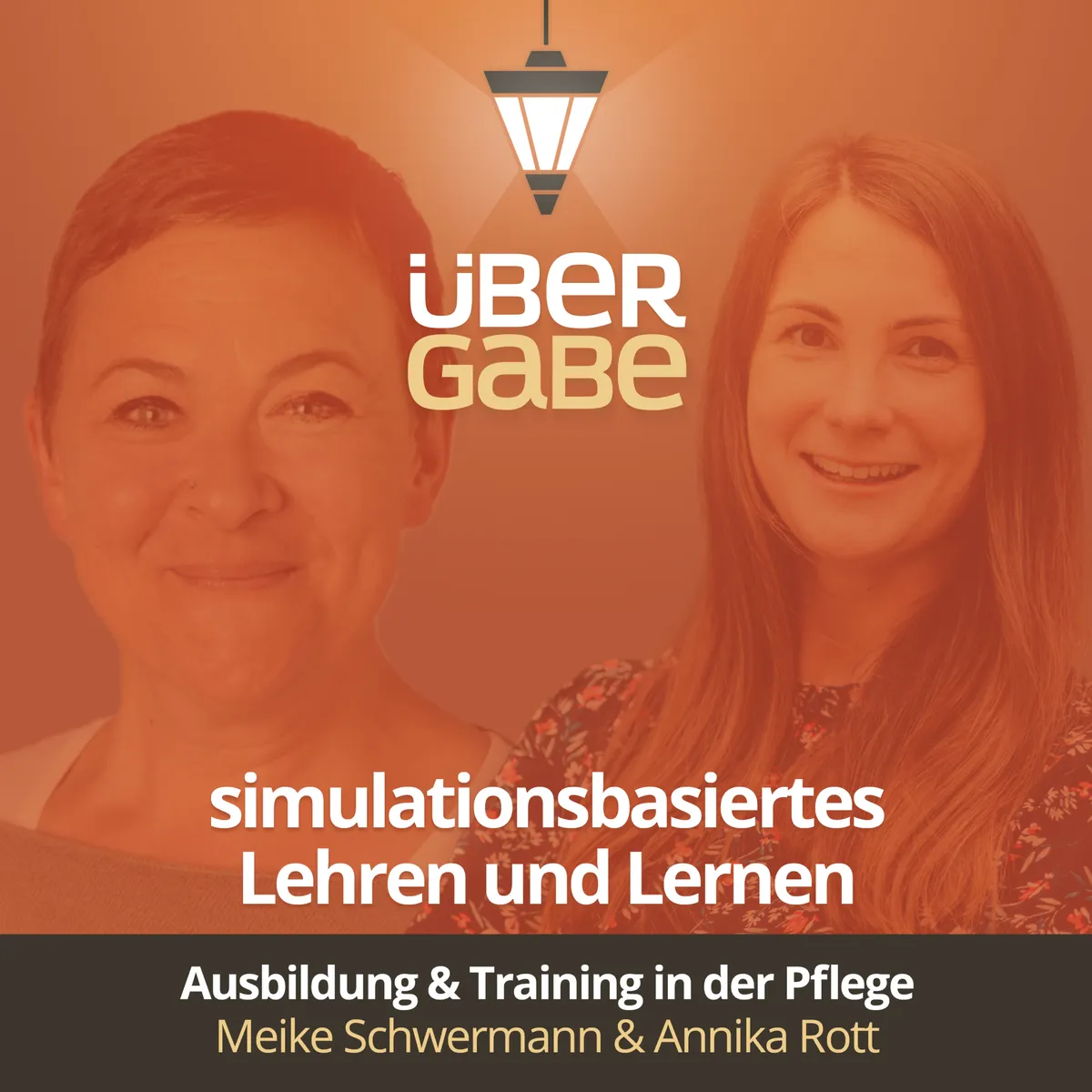Simulation in der Pflege – Wie wir mit Fehlern lernen, bevor sie passieren
In der Pflege werden täglich Entscheidungen getroffen, die über Wohlbefinden, Gesundheit oder sogar Leben entscheiden. Doch wie können Pflegefachpersonen auf diese Herausforderungen vorbereitet werden, ohne dabei Patient:innen zu gefährden? Eine Antwort darauf bietet das simulationsbasierte Lehren und Lernen – eine Methode, die nicht nur Skills trainiert, sondern vor allem Denken, Haltung und Kommunikation stärkt.
Im Zentrum steht dabei ein geschützter Raum: Simulationen ermöglichen das Durchspielen realitätsnaher Szenarien ohne reale Konsequenzen. Fehler dürfen gemacht werden – ja, sie sind sogar erwünscht. Denn nur wer reflektiert, entwickelt sich weiter. Genau das macht Simulation zu einem so wirkungsvollen Lernformat.
Was ist Simulation – und was nicht?
Der Begriff Simulation umfasst viele Formen: von einfachen Skills-Trainings wie dem Legen eines Blasenkatheters bis hin zu komplexen, szenarienbasierten Notfallsituationen mit Schauspielpersonen oder Simulatoren. Entscheidend ist nicht die Technik, sondern das Ziel.
Simulation ist keine „Puppe in einem Raum“. Es ist ein methodisch geplantes Lernsetting mit einem klar definierten Ziel. Ob Kommunikationstrainings, Entscheidungsfindung in ethischen Dilemmata oder Schmerzmanagement: Jede Simulation verfolgt ein konkretes Kompetenzziel – fachlich, sozial oder kommunikativ.
„Simulation ermöglicht es, Pflege zu erleben – ohne den Druck der Realität, aber mit all ihren Anforderungen.“ – Meike Schwermann
Dabei spielt die Qualität der Durchführung eine zentrale Rolle. Professionelle Simulationstrainer:innen bereiten nicht nur Szenarien vor, sondern begleiten die Teilnehmenden durch ein strukturiertes Pre-Briefing, eine realitätsnahe Umsetzung und ein reflexives Debriefing. Dieser letzte Schritt – das gemeinsame Reflektieren des Erlebten – ist oft der eigentliche Lernmoment.
Warum Simulation gerade jetzt wichtig ist
Die Pflege steht unter Druck: Fachkräftemangel, steigende Anforderungen und wachsende Komplexität prägen den Berufsalltag. Gleichzeitig ist die Ausbildung reformiert worden – durch das Pflegeberufegesetz und die hochschulische Pflegebildung.
Simulationen bieten hier eine Brücke zwischen Theorie und Praxis. Sie ermöglichen standardisierte Lerngelegenheiten, die unabhängig vom Zufall der Praxisverläufe stattfinden. Wo auf Station ein Notfall selten ist, kann er simulativ gezielt erlebbar gemacht werden. Wo Kommunikation mit sterbenden Menschen herausfordernd ist, kann sie trainiert und reflektiert werden – ohne Schaden anzurichten.
Nicht zuletzt fordern neue Curricula sogar Simulationen: In hochschulischen Ausbildungen dürfen bis zu 10 % der praktischen Einsätze durch Simulation ersetzt werden. Die Relevanz steigt – die Umsetzung hinkt jedoch oft noch hinterher.
Vom Verein zum Netzwerk: SimNAT als Motor für Qualität
Seit 2012 vernetzt das Simulationsnetzwerk Pflege (SimNAT) Fachpersonen, Lehrende und Einrichtungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Ziel ist der Austausch über Methoden, Standards und Weiterentwicklungen. Über 500 Mitglieder – Einzelpersonen, Schulen, Hochschulen, Kliniken – engagieren sich ehrenamtlich.
SimNAT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Simulation auf eine fundierte Grundlage zu stellen. Dazu gehört u. a. die Übersetzung und Anpassung der internationalen „INACSL Standards“ – Leitlinien aus den USA, die evidenzbasiert darlegen, wie Simulationen geplant, durchgeführt und ausgewertet werden sollten. Denn: Nicht alles, was aussieht wie Simulation, hat auch didaktische Qualität.
Arbeitsgruppen entwickeln im Netzwerk Szenarien, Checklisten, Formate für Debriefings oder auch ganze Weiterbildungen für Simulationstrainer:innen. Wer heute Simulation neu aufbauen will, muss nicht bei null anfangen – kann aber aktiv mitgestalten.
Reflexion statt Reproduktion: Was Simulation leistet
Ein wesentlicher Unterschied zur klassischen Praxisanleitung liegt im Fokus: Während in der Praxis der unmittelbare Handlungsdruck dominiert, schafft Simulation Raum für Reflexion. Die Lernenden agieren ohne den Druck der Bewertung – zumindest dann, wenn Simulationen nicht als Prüfungsform eingesetzt werden.
„Die Reflexion nach einer Simulation ist der eigentliche Lerneffekt – nicht die perfekte Ausführung.“ – Annika Rott
Diese sichere Lernumgebung wirkt wie ein Katalysator: Lernende trauen sich mehr, sie probieren aus, sie stellen Fragen. Die Atmosphäre ist von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt. Die Trainierenden sind keine Bewertenden, sondern Begleitende. Und das verändert alles.
Nicht zuletzt ermöglicht Simulation auch die Förderung personaler Kompetenzen: Selbstwirksamkeit, Umgang mit Emotionen, Resilienz, Teamfähigkeit. Kompetenzen, die im Alltag zählen, aber im klassischen Unterricht oft untergehen.
Simulation ist teuer – und trotzdem unverzichtbar
Die Ausstattung eines Simulationszentrums ist aufwendig: Räume, Technik, Personal, Vorbereitung. All das kostet – nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit. Dennoch: Simulation lohnt sich.
Nicht nur, weil sie Kompetenzen fördert, die anders kaum zu vermitteln sind. Sondern auch, weil sie langfristig Qualität und Sicherheit verbessert. In den USA zum Beispiel senken einige Versicherer bereits die Prämien, wenn Kliniken regelmäßige Simulationstrainings nachweisen. Die Logik ist einfach: Wer gut vorbereitet ist, macht weniger Fehler.
In Deutschland fehlt diese Verknüpfung bisher. Aber erste Studien zeigen: Simulation hat Potenzial – auch wenn großangelegte Langzeitstudien zur Mortalitätsreduktion noch fehlen.
Zwischen Praxis und Vision: Simulation in der Ausbildung
Simulation lässt sich curricular verankern – sowohl in der beruflichen als auch in der hochschulischen Ausbildung. An der Fachhochschule Münster etwa entwickeln Studierende im Berufspädagogik-Studiengang eigene Szenarien für pflegewissenschaftliche Settings – etwa zum Expertenstandard Schmerzmanagement. Diese Szenarien werden dann mit Studierenden des B.Sc.-Studiengangs Pflege durchgeführt und gemeinsam ausgewertet.
So entstehen nicht nur didaktisch fundierte Lernsituationen, sondern auch interprofessionelle Kooperationen. Theorie trifft Praxis, Lehre trifft Simulation, Pflege trifft Pädagogik.
Der Vorteil: Die zukünftigen Lehrenden lernen, wie Simulationen geplant, durchgeführt und reflektiert werden. Denn Simulation ist keine Technikfrage, sondern eine Haltung.
„Simulation ist keine Spielerei – sie ist eine der wenigen Methoden, um sichere Lernräume zu schaffen.“ – Lukas
Simulation und Technik: Zwischen VR-Brillen und Pflegeethik
Augmented und Virtual Reality halten Einzug in die Pflegeausbildung – auch im Simulationsbereich. In Münster werden VR-Brillen z. B. genutzt, um Pre-Briefings zu simulieren oder Beratungsprozesse aus der Ich-Perspektive erlebbar zu machen.
Noch ist der Mehrwert nicht immer klar. Manche handlungsorientierten Szenarien lassen sich besser praktisch als virtuell üben. Doch die Entwicklung geht weiter – und mit ihr die Frage: Wo ergänzt Technologie sinnvoll die menschliche Interaktion?
Wichtig bleibt dabei ein ethischer Blick: Technik darf nicht den Menschen verdrängen. Simulation ist kein Selbstzweck, sondern dient dem Ziel, Pflege menschlich, sicher und professionell zu gestalten.
Simulation als Prüfungsform? Eine Debatte mit Spannweite
In der Ausbildung und im Studium wird Simulation zunehmend auch als Prüfungsform genutzt. Das hat Vorteile: Situatives Handeln wird beobachtbar, Soft Skills lassen sich zumindest teilweise erfassen. Doch es birgt auch Risiken.
Simulation kann ihren geschützten Charakter verlieren, wenn Lernende wissen, dass sie bewertet werden. Angst ersetzt Neugier, Perfektion ersetzt Ausprobieren. Darum ist es entscheidend, zwischen Lernsimulationen und Prüfungssimulationen zu unterscheiden – didaktisch und organisatorisch.
Zukunftsmusik: Simulation als Zugang zur Pflege?
Ein Gedanke, der in der Podcastfolge aufkommt, ist provokant: Könnte Simulation irgendwann ein Auswahlverfahren für den Pflegeberuf werden? Statt Schulnoten würden Kompetenzen, Haltung und Kommunikationsfähigkeit im Vordergrund stehen.
Eine mutige Idee – und ein realistischer Blick auf das, was Pflege wirklich braucht: Menschen, die handeln können, reflektieren wollen und empathisch bleiben. Simulation kann helfen, diese Stärken sichtbar zu machen. Nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Personalentwicklung.
Fazit: Simulation ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit
Simulation ist mehr als eine Methode. Sie ist eine Haltung. Sie stellt das Lernen ins Zentrum, erlaubt Fehler, fördert Reflexion. Und sie zeigt: Gute Pflege entsteht nicht zufällig, sondern durch gezielte Vorbereitung.
Damit Simulation ihre Wirkung entfalten kann, braucht es Ressourcen – Räume, Zeit, Personal. Aber vor allem braucht es Menschen, die an sie glauben. Menschen wie Meike Schwermann, Annika Rott und die vielen anderen, die Simulation in der Pflege vorantreiben.
Denn Pflege ist komplex – und wer ihr mit Kompetenz begegnen will, braucht Lernräume, die genau das ermöglichen. Simulation ist einer davon.
Shownotes
- Kontaktdaten Meike Schwermann
- Kontaktdaten Annika Rott
- Simulationsnetzwerk in der Pflege
- Simulationsbasiertes Lernen im Skills Lab FH Münster
- Simulationszentrum (FranziskusSIM) am St. Franziskus-Hospital Münster
- Simulation als Lehr-Lernmethode - Vollständige Überarbeitung der SimNAT Pflege e.V. Leitlinie 2020
- INACSL Standards Committee (2021) Healthcare Simulation Standards of Best PracticeTM Professional Development. Clinical Simulation in Nursing, Vol 58, 5-8. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.007
- DigitalPakt Schule
- SPIKES-Modell zur Überbringung schlechter Nachrichten
- Rahmenpläne für die Pflegeausbildungen