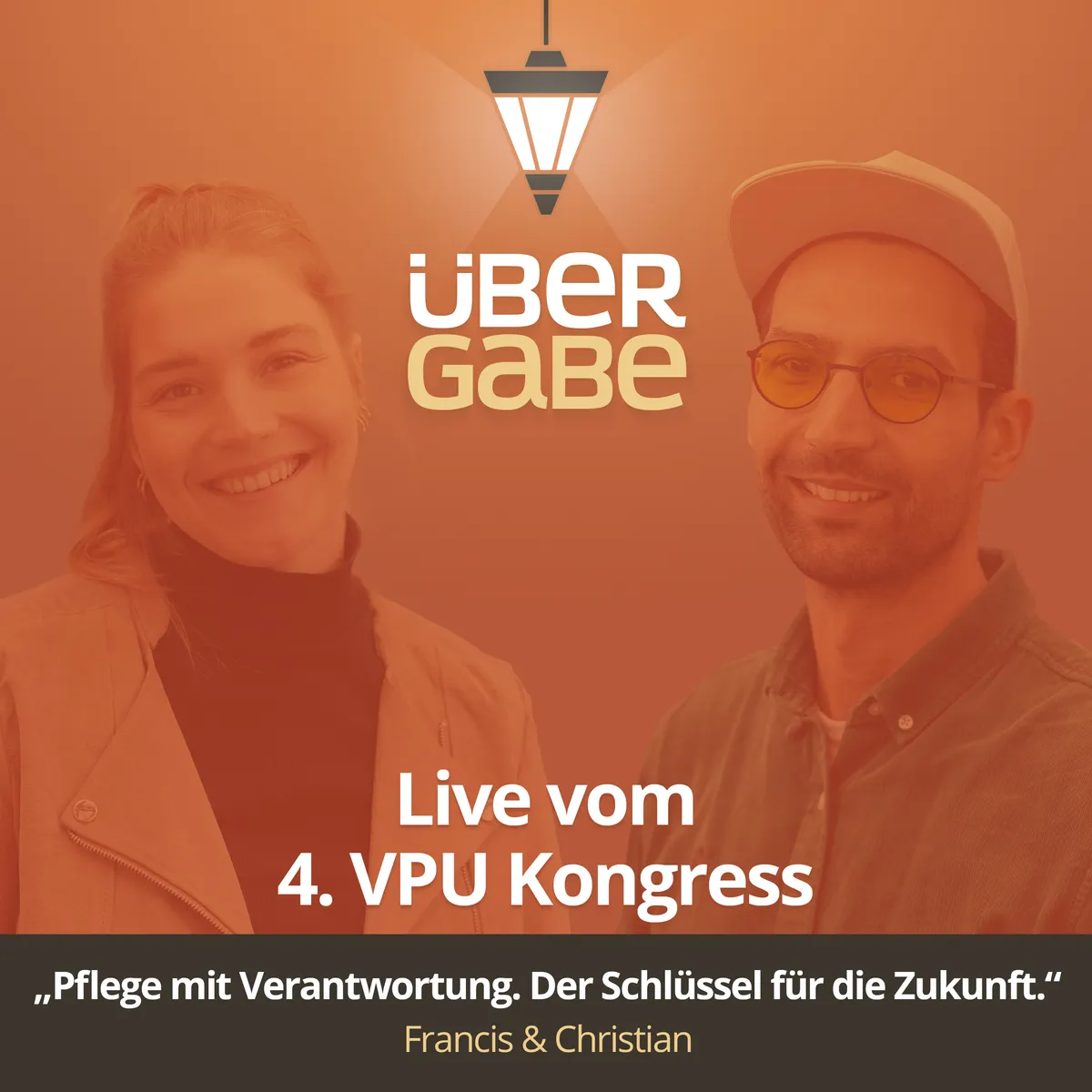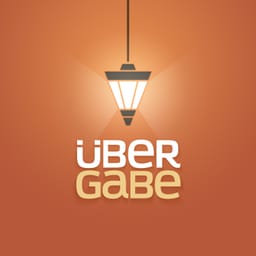Der VPU-Kongress als Kompass für die Zukunft
Der Verband der Pflegedirektor:innen der Universitätskliniken (VPU) ist seit 1984 eine zentrale Organisation, die sich strategisch für die Interessen von über 70.000 Pflegefachpersonen einsetzt und regelmäßig den gleichnamigen Kongress ausrichtet. Auf dem vierten VPU-Kongress in Berlin, der unter dem Motto „Pflege mit Verantwortung – der Schlüssel für die Zukunft“ stattfand, wurde deutlich, dass Universitätskliniken eine Vorreiterrolle in der Etablierung wissenschaftsbasierter Pflege spielen. Der Fokus der Veranstaltung lag auf Innovation, Entwicklung und der notwendigen hochschulischen Qualifizierung der Pflegefachpersonen.
Der Kongress spiegelte die wachsende Bedeutung der Akademisierung in der Pflege wider, insbesondere die Integration von Pflegewissenschaftler:innen und Advanced Practice Nurses in die Organisation der Kliniken. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Etablierung internationaler Standards, die Entwicklung kohärenter Bildungsarchitekturen und die Notwendigkeit gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung nachhaltig zu sichern.
Der VPU und die Strategie der Akademisierung
International ist die hochschulische Qualifikation von Pflegefachpersonen der Standard, wobei in manchen Ländern bis zu 93 Prozent der Pflegefachpersonen über einen Bachelor- oder Master-Abschluss verfügen. Im Gegensatz dazu befindet sich Deutschland noch in einer Entwicklungsstufe, was die Implementierung erweiterter Rollen betrifft. Der VPU sieht sich hier in der Rolle, Innovationen voranzutreiben und die Studiengänge zu etablieren.
Advanced Nursing Practice (ANP) erfordert Master-Absolvent:innen mit klinischem Fokus. Eine Erhebung ergab, dass in Deutschland aktuell schätzungsweise nur etwa 100 APNs zu finden sind. Das zentrale Problem liegt in der mangelnden Vereinheitlichung der Rollendefinition, da APN-Tätigkeiten zwar an vielen Standorten stattfinden, jedoch oft unter anderen Bezeichnungen geführt werden, wie zum Beispiel als onkologische Pflegefachexpert:innen, die in Tumorboards auf Augenhöhe mit Mediziner:innen und anderen Gesundheitsfachberufen an der Therapiebestimmung mitwirken. Die Intention des VPU ist es, eine Leuchtturmfunktion zu übernehmen, um die Rollen zu erschließen, die Notwendigkeit dieser Funktion zu betonen und eine Vereinheitlichung herbeizuführen. Die Pflegedirektionen betrachten die hochschulische Qualifizierung und die Rolle der APNs als notwendigen Motor für die Pflegeentwicklung.
Die internationale Perspektive ist dabei essentiell, um aus den Erfahrungen anderer europäischer Länder wie dem Vereinigten Königreich (UK) zu lernen, in dem die Einführung von APN-Rollen ein langwieriger Prozess war. Es ist notwendig, dass Deutschland international anschlussfähig wird, um eine Harmonisierung zu erreichen, da hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen aus dem Ausland oft nicht in das deutsche System passen. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, die deutsche Expertise aktiver in den internationalen Kontext einzubringen.
BAPID: Ein kohärentes Fundament für Karrierewege und zukünftige Kompetenzen
Die Diskussion um die Akademisierung ist eng mit der zukünftigen Bildungsarchitektur verbunden. Professor Dr. Wolfgang von Gahlen Hoops stellte das BAPID-Modell (Bildungsarchitektur der Pflege in Deutschland) vor, das als Reaktion auf die Gesetzesnovellierung von 2020 entwickelt wurde. Ziel war die Erstellung einer Kompetenzmatrix, die alle Pflegeberufe sowie die nicht-formelle Pflege miteinbezieht. Das Modell versucht, eine eigene Typologie zu schaffen, da die bisherige Verortung von Pflegeberufen innerhalb des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR), beispielsweise die Verortung von Pflegeassistenz und Pflegefachperson auf derselben Stufe 4, als inkohärent empfunden wurde.
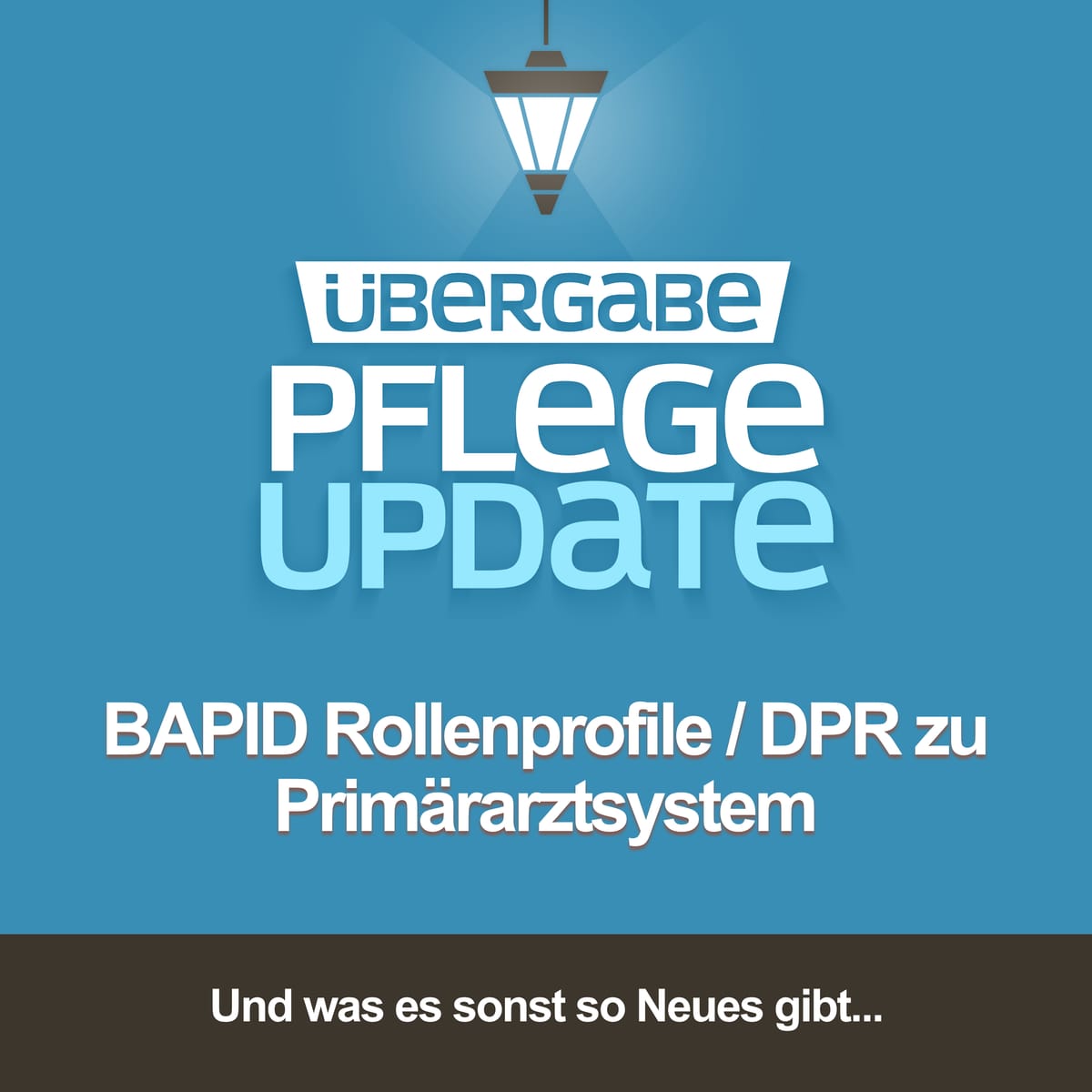
Podcast-Episode zum BAPID-Modell
Das Herzstück des BAPID-Modells liegt in der Schaffung durchlässiger Karrierewege. Es soll Pflegefachpersonen ermöglichen, sich vom Pflegefachassistenten über die Pflegefachperson bis hin zur akademischen Ebene (Bachelor, APN, promovierte Pflegefachperson) weiterzuentwickeln, ohne von Null beginnen zu müssen, da Qualifikationen anerkannt werden.
Die Entwicklung des Modells erfolgte in mehreren Phasen (BAPID I und II) und basierte auf einer umfangreichen Dokumentenanalyse, Expert:innen-Interviews und einer KI-gestützten Analyse existierender Dokumente wie Modulhandbüchern. Dabei wurden auch zukünftige Bildungsbedarfe bis 2035/2040 identifiziert, darunter Disaster Nursing, Digitalisierung, Professionalisierung und der demografische Wandel, sowie Themen wie Planetary Health und die Auswirkungen von Klimawandel und Hitze.
Das BAPID-Modell hat weitreichende Implikationen für das Pflegemanagement. Es erfordert eine Neuausrichtung der Personalplanung. Ein geteiltes Leadership, bei dem APNs oder promovierte Pflegefachpersonen das Fachliche im Blick behalten, kann das Management, das oft stark mit Personal- und Versorgungsmanagement beschäftigt ist, entlasten und den fachlichen Standard sicherstellen. Die Umsetzung in die Praxis erfordert jedoch eine Haltungsänderung und eine bewusste Gestaltung der Prozesse, anstatt theoretische Modelle direkt zu kopieren. Erste Auswertungen von bereits existierenden BAPID-Stellenprofilen zeigten, dass klinische Kompetenzen gut adressiert sind, Bereiche wie Prävention, Gesundheitsförderung und digitale Kompetenzen jedoch noch Nachjustierungsbedarf haben.
APN und das PEPPA-Framework als Motor der Versorgungsinnovation
Die konkrete Etablierung von APN-Rollen an Unikliniken wurde am Beispiel der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) veranschaulicht. Die MHH verfolgte seit 2017 die Vision der Pflegedirektion zur Implementierung und etablierte 2019 ein APN-Programm. Mittlerweile arbeiten dort neun APNs, deren Expertise zur besseren Bewältigung komplexer Versorgungssituationen führt und die Akzeptanz bei Medizin und anderen Berufsgruppen erhöht hat.
Die Rollen an der MHH orientieren sich an spezifischen Patient:innengruppen mit komplexen Pflegeproblemen, wie beispielsweise neuro-onkologischen Patient:innen oder Patient:innen mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Grundlage der Implementierung bildet das PEPPA-Framework, ein international anerkanntes kanadisches Modell. Die MHH hat die neun Schritte des Frameworks auf fünf vereinfacht. Der Prozess beginnt mit der Analyse der Patient:innengruppe, der Stakeholder und des Versorgungsmodells, gefolgt von der Identifizierung der Schnittstellen, in denen die APN ihre Expertise einbringen kann, und endet mit der kontinuierlichen Evaluation der Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen.
Eine Selbstüberprüfung der MHH-APNs mithilfe des australischen APRD-Tools ergab, dass der Bereich der Clinical Practice sehr ausgeprägt ist, während Bildung und Leadership zwar verortet, aber weniger dominant sind. Der Fragebogen offenbarte die strukturellen Defizite in Deutschland: Die fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben APNs keine eigenständige Diagnostik oder die Verschreibung von Heil- und Hilfsmitteln, was die Erfüllung des vollen Spektrums internationaler APN-Tätigkeiten erschwert. Hinzu kommt die starke Trennung der Versorgungssektoren, da das Framework international stark auf die Anwendung in der Community Health und der Gesundheitsprävention ausgerichtet ist, die im deutschen Krankenhausbereich kaum abgebildet werden kann. Ein wichtiger politischer Wunsch ist daher die Aufweichung der Sektorengrenzen und eine Vergütung von Pflegefachpersonen, insbesondere in der Nachsorge und im ambulanten Bereich.
Community Health Nursing und regionale Versorgungsstrategien
Die Community Health Nurses (CHN) gelten als ein zentrales Zukunftsfeld des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK). Obwohl CHN primär für die kommunale und ambulante Primärversorgung konzipiert ist, zeigen sich auch an Universitätskliniken Ansätze zur Verankerung dieser Rolle. Am Universitätsklinikum Augsburg wurde eine CHN in der Stabstelle Digitalisierung und Pflegewissenschaft etabliert.
Die Rolle der CHN an der Uniklinik zielt darauf ab, die Versorgung gesundheitsfördernd und präventiv weiterzuentwickeln. Dies beinhaltet die Stärkung der Health Literacy von Patient:innen vor dem Krankenhausaufenthalt sowie die Vorbereitung auf die Entlassung, um Rehospitalisierungen zu vermeiden. Die Identifikation von Patient:innen erfolgt durch Advanced Practice Nurses (APNs) und Highly Qualified Practitioners (HQPs) auf den Stationen, die Interventions- und Beratungsbedarfe erkennen. Die Tätigkeit umfasst Beratungsgespräche zur Klärung von Bedarfen und Ressourcen sowie die Kontaktaufnahme nach der Entlassung, um Informationen an nachversorgende Teams weiterzugeben.
Gesundheitspolitisch ist für die CHN ein wichtiger Fortschritt die Änderung der gesetzlichen Grundlagen, um die selbstständige Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten ohne ständigen Arztkontakt zu ermöglichen.
Die Herausforderungen der Gesundheitsversorgung in ländlichen Räumen, besonders in Bezug auf das Entlassmanagement, wurden anhand des Innovationsfondsprojekts „NAHVERSORGT“ in Mecklenburg-Vorpommern beleuchtet. Die Region steht vor gravierenden demografischen Problemen, wie einer der ältesten Bevölkerungen Deutschlands und einer sehr geringen Bevölkerungsdichte. Das Projekt arbeitet mit „Runden Tischen“ – freiwilligen, multiprofessionellen Zusammenschlüssen aus Pflege, Politik, Verwaltung und Wohnungsbau. Die zentrale Frage ist, wie eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung nachhaltig gesichert und durch langfristige Finanzierungsmodelle untermauert werden kann. Die methodische Begleitung identifizierte als Kernherausforderungen die Notwendigkeit regionaler Verankerung, Nachhaltigkeit und interprofessioneller Zusammenarbeit. Eine Gefahr, die es zu vermeiden gilt, sind Doppelstrukturen, wie beispielsweise die Konkurrenz zwischen Nachbarschaftshilfe und der Inanspruchnahme des Entlastungsbetrags durch die ambulante Pflege.
Magnet-Prinzipien, Shared Governance und der Innovationspreis
Die internationale Ausrichtung der Pflege zeigt sich auch in der Adaption von Modellen wie Magnet. Das in den 1980er Jahren in den USA entstandene Konzept zielt auf die Schaffung exzellenter Arbeitsumgebungen für Pflegefachpersonen ab, was direkt zu exzellenten Patientenergebnissen führt. Die fünf Kernkomponenten sind transformationale Führung, strukturelles Empowerment, neues Wissen/Innovation, empirische Outcomes und professionelle Praxis.
Die Studie „Magnet for Europe“ (nun „Magnet für Deutschland“) untersucht die Übertragbarkeit dieser Prinzipien auf den europäischen und deutschen Kontext. Die Ergebnisse bestätigten die grundlegende Implementierbarkeit der Komponenten, obgleich Herausforderungen im deutschen System bestehen, insbesondere die Anforderung an alle Pflegefachpersonen in Leitungspositionen, über einen Hochschulabschluss zu verfügen.
Die Forschung zeigt einen Zusammenhang zwischen verbesserten Arbeitsbedingungen und der psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden. Kliniken mit einer besseren Personalbesetzung verzeichnen signifikant geringere Burnout-Raten. Die Nichtdurchführung von Tätigkeiten aufgrund von Zeitmangel, die für Zuwendung und Interaktion elementar sind, führt zu Unzufriedenheit und kann zu Burnout beitragen.
Ein Schlüsselelement des Magnet-Konzepts ist Shared Governance, eine Struktur der partizipativen Führung. Hierbei werden Pflegefachpersonen ohne Führungsverantwortung in Entscheidungen eingebunden. Am Universitätsklinikum Bonn wird eine „Unit-Based Shared Governance“-Struktur pilotiert, bei der Beratungsgremien auf Stations- oder Abteilungsebene (Unit Councils) gebildet werden. Ziel ist es, Entscheidungen an den Ort des Geschehens zurückzugeben und die Fachexpertise der Pflegefachpersonen zu stärken. Die Umsetzung führt zu einer deutlichen Steigerung des Engagements und der Motivation der beteiligten Pflegefachpersonen. Die klassische Führungsrolle löst sich dabei nicht auf, sondern wandelt sich hin zu einer transformationalen und partizipativen Kultur.
Die Bedeutung der Pflegewissenschaft für die Qualitätsentwicklung manifestierte sich im Innovationsprojekt des Klinikums Oldenburg, das den Preis des Pflegeinnovators des Jahres gewann. Die Stabstelle Pflegewissenschaft in Oldenburg treibt die Akademisierung durch die Etablierung von Rollen für Bachelor- und APN-Absolvent:innen voran. Aktuell sind 23 Kolleg:innen als Pflegeexpert:innen (Bachelor-Abschluss) eingestellt, die einen Teil ihrer Arbeitszeit für Projekte wie Leitlinienentwicklung und Schulungen nutzen.
Das Projekt zeichnet sich durch gelebten Praxistransfer und interprofessionelle Kooperation aus. Beispiele sind die Entwicklung eines Simulationsroboters zur Schulung von Delir-Assessments auf der Intensivstation, die Durchführung von Konzilien für Patient:innen mit Delir oder Demenz, sowie umfassende Sturzpräventionsmaßnahmen. Ein weiteres leicht umsetzbares Projekt ist die Eli-Box (für Hörgeräte, Brillen, Zahnprothesen), die operativen Patient:innen zur besseren Orientierung und Kommunikation während Übergaben mitgegeben wird. Diese Projekte sind evidenzbasiert, aus der Praxis abgeleitet und zielen konsequent auf die qualitative Verbesserung der Patientenversorgung ab.
Ein weiterer innovativer Ansatz zur Personalbindung wurde aus Jena vorgestellt: Ein verlängertes Orientierungsprogramm für frisch examinierte Pflegefachpersonen. Statt sich direkt festlegen zu müssen, können die Absolvent:innen innerhalb eines Jahres mehrere Bereiche kennenlernen und erst dann eine endgültige Entscheidung treffen. Dieses fakultative Programm reduziert den Entscheidungsdruck und wird von den Absolvent:innen sehr geschätzt.
Politische Impulse und die Kraft des gemeinsamen Fortschritts
Die Diskussionen auf dem VPU-Kongress machten deutlich, dass die Entwicklung innovativer Versorgungsstrukturen nur gelingen kann, wenn die politischen Rahmenbedingungen angepasst werden. Es fehlt nicht nur an entsprechenden Gesetzen, sondern vor allem an tragfähigen Finanzierungsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Pflege. Gefordert wird die Stärkung der Stimme der Pflege in strategischen Entscheidungsgremien, unter anderem durch die Aufnahme von Pflege in den Vorstand von Kliniken.
Insgesamt ist die Entwicklung der Pflege in Deutschland ein langwieriger Prozess, der Mut und Beharrlichkeit erfordert. Doch die Vielzahl an akademischen Projekten, die auf dem Kongress präsentiert wurden, zeigt, dass das Thema Akademisierung Wurzeln geschlagen hat. Die Erkenntnis, dass komplexe Herausforderungen wie der demografische Wandel nur durch Netzwerkarbeit und das Teilen von Erfahrungen bewältigt werden können, ist zentral. Oder, um es mit einem Sprichwort auszudrücken: „If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together“. Dieser Kongress lieferte die notwendigen Impulse und Role Models, um diesen gemeinsamen Weg fortzusetzen.
Diskutier mit professionell Pflegenden in unserem Community Board!

Solltest du Interesse daran haben, bei uns im Newsletter oder im Podcast zu werben oder eine Stellenanzeige zu schalten, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme per E-Mail: [email protected]